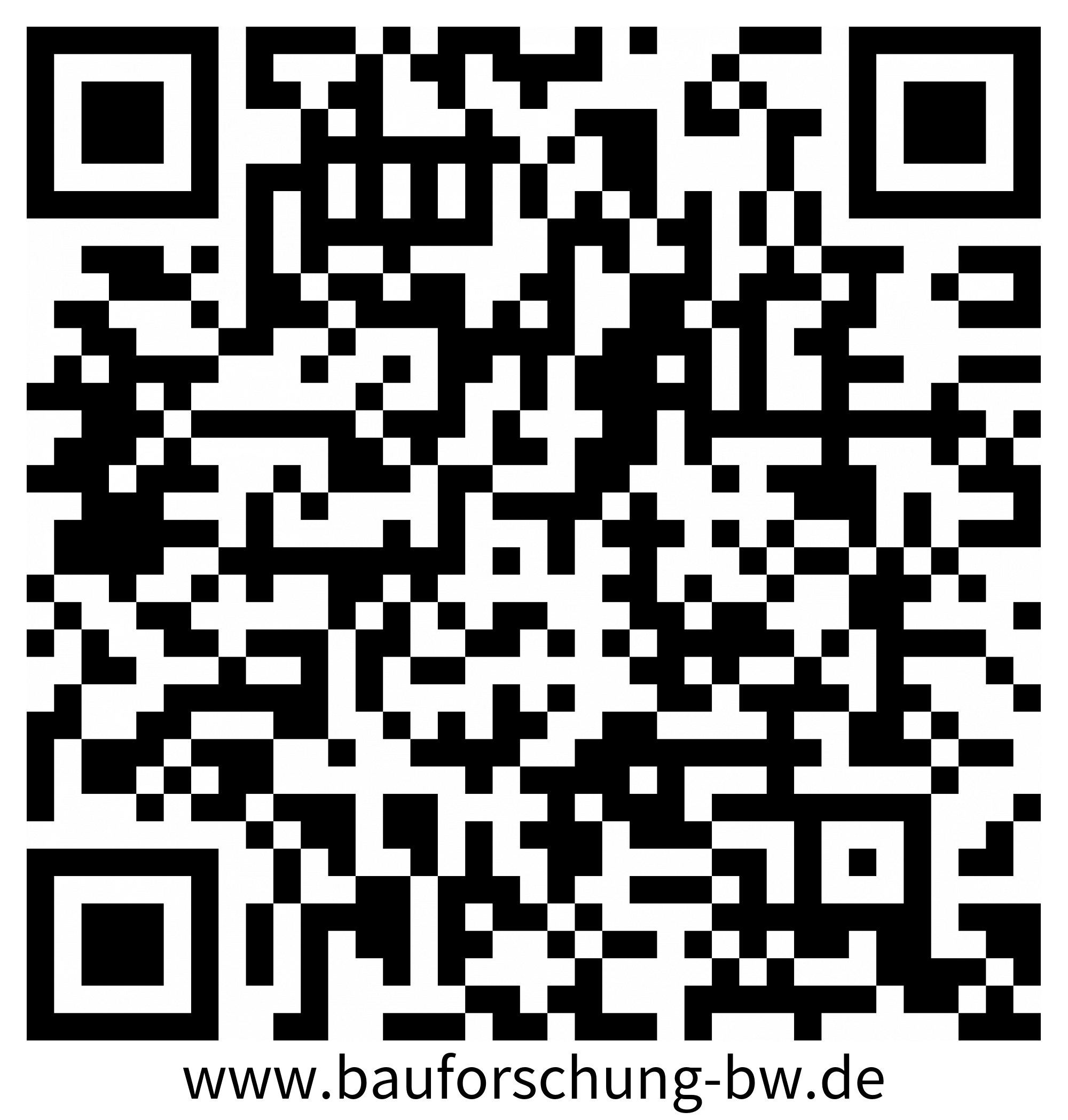Wohn- und Geschäftshaus
ID:
107221838717
/
Datum:
15.10.2025
Datenbestand: Bauforschung
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Scheuerlenstraße |
| Hausnummer: | 17 |
| Postleitzahl: | 79822 |
| Stadt-Teilort: | Titisee-Neustadt |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8315113067 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Ehem. Kapuzinerkloster, Klösterle 3,4,5,6 (79822 Titisee-Neustadt)
Basili-Schmiede, Pfauenstraße 1 (79822 Titisee-Neustadt)
Wohnhaus, Scheuerlenstraße 30 (79822 Titisee-Neustadt)
Münster St. Jakobus, Scheuerlenstraße 4 (79822 Titisee-Neustadt)
Wohnhaus, Schillerstraße 3 (79822 Titisee-Neustadt)
Wohnhaus, Wilhelm-Stahl-Straße 5 (79822 Titisee-Neustadt)
Basili-Schmiede, Pfauenstraße 1 (79822 Titisee-Neustadt)
Wohnhaus, Scheuerlenstraße 30 (79822 Titisee-Neustadt)
Münster St. Jakobus, Scheuerlenstraße 4 (79822 Titisee-Neustadt)
Wohnhaus, Schillerstraße 3 (79822 Titisee-Neustadt)
Wohnhaus, Wilhelm-Stahl-Straße 5 (79822 Titisee-Neustadt)
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Die Erbauung des Kernbaus erfolgte 1620 (d). Um das Jahr 1775 (d) wurde dieser verlängert und 1801 (d) verbreitert. Weitere Umbaumaßnahmen datieren in das 19. Jahrhundert und ab der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1. Bauphase:
(1620)
(1620)
Kernbau von 1620 (d)
Gesicherte Aussagen zur baulichen Entwicklung lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt in erster Linie im offen zugänglichen Dach ablesen.
Danach fixiert die älteste erkannte Dachkonstruktion, die nach der dendrochronologischen Untersuchung von Stefan King, Freiburg in die Jahre um 1620 (d) zu datieren ist, einen kleinen, sich in der Nordostecke des Gesamtgebäudes abzeichnenden Kernbau.
Gesicherte Aussagen zur baulichen Entwicklung lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt in erster Linie im offen zugänglichen Dach ablesen.
Danach fixiert die älteste erkannte Dachkonstruktion, die nach der dendrochronologischen Untersuchung von Stefan King, Freiburg in die Jahre um 1620 (d) zu datieren ist, einen kleinen, sich in der Nordostecke des Gesamtgebäudes abzeichnenden Kernbau.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
2. Bauphase:
(1775)
(1775)
Verlängerung des Kernbaus um das Jahr 1775 (d)
Wie schon beim Kernbau, ist auch der Umfang der ersten gravierenden Baumaßnahme im Dachraum ablesbar. Danach wurde um das Jahr 1775 (d) der südliche Vollwalm des Kernbaus abgebrochen und durch eine Satteldachfläche in Richtung Süden ersetzt. Als tragendes Gerüst kam eine in älterer Tradition stehende und in zwei Punkten abweichende Dachkonstruktion zur Anwendung. So reduzierte sich die neue Längsaussteifung auf kurze, zwischen Bundstreben und Firsträhm verlaufende Gefügehölzer und als Dachabschluss im Süden wurde kein Vollwalm, sondern ein Halbwalm ausgeführt.
Wie schon beim Kernbau, ist auch der Umfang der ersten gravierenden Baumaßnahme im Dachraum ablesbar. Danach wurde um das Jahr 1775 (d) der südliche Vollwalm des Kernbaus abgebrochen und durch eine Satteldachfläche in Richtung Süden ersetzt. Als tragendes Gerüst kam eine in älterer Tradition stehende und in zwei Punkten abweichende Dachkonstruktion zur Anwendung. So reduzierte sich die neue Längsaussteifung auf kurze, zwischen Bundstreben und Firsträhm verlaufende Gefügehölzer und als Dachabschluss im Süden wurde kein Vollwalm, sondern ein Halbwalm ausgeführt.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
3. Bauphase:
(1801)
(1801)
Verbreiterung des verlängerten Gebäudes um das Jahr 1801 (d)
Spätestens mit der Verbreiterung um das Jahr 1801 (d) wird der bestehende Altbestand um eine landwirtschaftlich genutzte Zusatzfläche erweitert. Mit einer neuen, in diesem Fall stehenden Dachkonstruktion eingedeckt, ist das ausschlaggebende Indiz für diesen Funktionswandel die zu diesem Zeitpunkt am Südgiebel angelegte, auf älteren Fotos erkennbare Einfahrt.
Ehemals die gesamte Höhe des Unterbaus einnehmend, erstreckte sich die daran anschließende Tenne entlang der westlichen Kellerbegrenzung bis zum heutigen Treppenhaus.
Spätestens mit der Verbreiterung um das Jahr 1801 (d) wird der bestehende Altbestand um eine landwirtschaftlich genutzte Zusatzfläche erweitert. Mit einer neuen, in diesem Fall stehenden Dachkonstruktion eingedeckt, ist das ausschlaggebende Indiz für diesen Funktionswandel die zu diesem Zeitpunkt am Südgiebel angelegte, auf älteren Fotos erkennbare Einfahrt.
Ehemals die gesamte Höhe des Unterbaus einnehmend, erstreckte sich die daran anschließende Tenne entlang der westlichen Kellerbegrenzung bis zum heutigen Treppenhaus.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
4. Bauphase:
(1850)
(1850)
In das 19. Jahrhundert datieren weitere, in diesem Fall nicht absolut datierte Umbaumaßnahmen. Neben kleineren Veränderungen am Dach bezieht sich der gravierendste Umbau auf die massive Erneuerung der bauzeitlichen Wohnzone. Sie ersetzt die hölzerne Vorgängerkonstruktion und erfüllt die zwischenzeitlich gestiegenen Anforderungen an die häuslichen, in diesem Fall wohl auch gewerblich genutzten Feuerstellen.
Unweigerlich mit dem Umbau verbunden war nämlich nicht nur der Küchenherd und die Befeuerung des stubenseitigen Kachelofens, sondern auch die im Obergeschoss aufgemauerte Einrichtung einer in der lokalen Forschung geschichtlich überlieferten Goldschmiedewerkstatt.
Den zentralen Hinweis darauf liefert der im abgetrennten Dachraum erhaltene und über eine Zugvorrichtung bedienbare Blasebalg zur Erhöhung der Schmelztemperatur im eigens dafür aufgemauerten Schmelzofen, ausgestattet mit dem zugehörigen Gestänge zur Sauerstoffzufuhr.
Unweigerlich mit dem Umbau verbunden war nämlich nicht nur der Küchenherd und die Befeuerung des stubenseitigen Kachelofens, sondern auch die im Obergeschoss aufgemauerte Einrichtung einer in der lokalen Forschung geschichtlich überlieferten Goldschmiedewerkstatt.
Den zentralen Hinweis darauf liefert der im abgetrennten Dachraum erhaltene und über eine Zugvorrichtung bedienbare Blasebalg zur Erhöhung der Schmelztemperatur im eigens dafür aufgemauerten Schmelzofen, ausgestattet mit dem zugehörigen Gestänge zur Sauerstoffzufuhr.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
5. Bauphase:
(1950)
(1950)
Umbauten des 20. und 21. Jahrhunderts.
Mit den ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einsetzenden und bis in 21. Jahrhundert andauernden Umbauten erfuhr das Gebäude in historischer Hinsicht einen nachhaltigen, in denkmalpflegerischer Sichtweise nur schwer verständlichen Substanzverlust. Neben der wohnlichen, von den alten Strukturen abweichenden Umnutzung des Wirtschaftsteiles, der Neufassung und Aufweitung des Ladengeschäftes betrifft dies die umfangreichen Eingriffe in die Dachstrukturen bzw. das Einschneiden der Raumhöhen über die Dachbasis hinaus.
Mit den ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einsetzenden und bis in 21. Jahrhundert andauernden Umbauten erfuhr das Gebäude in historischer Hinsicht einen nachhaltigen, in denkmalpflegerischer Sichtweise nur schwer verständlichen Substanzverlust. Neben der wohnlichen, von den alten Strukturen abweichenden Umnutzung des Wirtschaftsteiles, der Neufassung und Aufweitung des Ladengeschäftes betrifft dies die umfangreichen Eingriffe in die Dachstrukturen bzw. das Einschneiden der Raumhöhen über die Dachbasis hinaus.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Dokumentation
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufseitig an der westlichen Seite der Scheuerlenstraße.
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Bei dem untersuchten Gebäude handelt es sich im Kern um einen teilverschindelten, ansonsten verputzten Holzgerüstbau mit späteren, in Holz bzw. in massiver Bauweise ausgeführten Anbauten, heute alles unter einem gemeinsamen Dach.
Mit seiner Osttraufe zur Straße ausgerichtet, gleicht ein niedriges, die halbe Gebäudebreite und gesamte Gebäudelänge einnehmendes Sockelgeschoss, das quer zum Firstverlauf ansteigende Gelände aus. Auf dem Sockel erhebt sich ein zweigeschossiger Unterbau mit einem an den Giebelseiten unterschiedlich abgewalmten Satteldach.
Mit seiner Osttraufe zur Straße ausgerichtet, gleicht ein niedriges, die halbe Gebäudebreite und gesamte Gebäudelänge einnehmendes Sockelgeschoss, das quer zum Firstverlauf ansteigende Gelände aus. Auf dem Sockel erhebt sich ein zweigeschossiger Unterbau mit einem an den Giebelseiten unterschiedlich abgewalmten Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
Kernbau von 1620 (d)
Die Ausmaße des sich im Dachraum abzeichnenden Kernbaus lassen sich unter Vorbehalt auf das Obergeschoss übertragen. Danach besaß der vom allseitig auskragenden Dach eingedeckte Obergeschossgrundriss eine dreizonige, quer zum Firstverlauf aufgereihte Gliederung. Entsprechend den vorliegenden Breiten handelte es sich bei der nördlichen Zone um die Wohnzone, bei der südlich angrenzenden Zone um die Flurzone und bei der abschließenden Zone mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Kammerzone.
Was die ursprüngliche Nutzung der einzelnen Räume angeht, geben die im Erdgeschoss aufgenommenen Befunde erste genauere Hinweise.
Beginnend mit der Wohnzone besteht kein Zweifel, dass es sich bei dem östliche Eckraum um die ursprüngliche Stube handelt.
Die Ausmaße des sich im Dachraum abzeichnenden Kernbaus lassen sich unter Vorbehalt auf das Obergeschoss übertragen. Danach besaß der vom allseitig auskragenden Dach eingedeckte Obergeschossgrundriss eine dreizonige, quer zum Firstverlauf aufgereihte Gliederung. Entsprechend den vorliegenden Breiten handelte es sich bei der nördlichen Zone um die Wohnzone, bei der südlich angrenzenden Zone um die Flurzone und bei der abschließenden Zone mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Kammerzone.
Was die ursprüngliche Nutzung der einzelnen Räume angeht, geben die im Erdgeschoss aufgenommenen Befunde erste genauere Hinweise.
Beginnend mit der Wohnzone besteht kein Zweifel, dass es sich bei dem östliche Eckraum um die ursprüngliche Stube handelt.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Werden die bislang vorliegenden Erkenntnisse zusammengefasst, wurde um das Jahr 1620(d) ein zweigeschossiger, auf einem massiven Sockelgeschoss errichteter Holzgerüstbau mit beidseitigem Vollwalmdach abgezimmert. Bezogen auf seine Grundriss- und Nutzungsgliederung besaß er eine dreizonige Gliederung, bestehend aus einer Wohn- Flur- und Kammerzone. Das wohnliche Zentrum mit verbohlter Stube und benachbarter Küche lag im Osten, wobei die Stube die Nordostecke einnahm. Entweder über eine Außentreppe an der Osttraufe oder über einen Längsflur am Südgiebel erschlossen, kann eine landwirtschaftliche Nutzung ausgeschlossen werden, so dass in erster Linie die Nutzung als Handwerkerhaus oder herrschaftliches Verwaltungsgebäude in Betracht zu ziehen ist.
Bestand/Ausstattung:
keine Angaben
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
keine Angaben
Konstruktion/Material:
Kernbau von 1620 (d)
Das maßgebliche Gerüst der zugehörigen Dachkonstruktion bilden zwei abgestrebte Querbünde mit dachhohen, durch angeblattete Kehlbalken stabilisierte Bundstreben. Kopfzonig tragen sie ein Firsträhm, an dessen Enden die Anfallspunkte zweier giebelseitigen Vollwalmflächen ansetzten. Neben dem Firsträhm erfolgt die Verbindung zwischen den Bundstreben durch zwei, auf halber Dachhöhe angeordnete, die Bundstreben überquerende Längsriegel. Zusammen mit dem Firsträhm und den sich dachhoch überkreuzenden Gefügehölzern übernehmen sie nicht nur die Längsaussteifung des Gesamtdaches, sie tragen auch die dachhauttragenden Hölzer.
Die dem Kerndach zugehörigen Hölzer sind rauchschwarz und deuten einen ehemals schornsteinlosen Rauchabzug an.
Das maßgebliche Gerüst der zugehörigen Dachkonstruktion bilden zwei abgestrebte Querbünde mit dachhohen, durch angeblattete Kehlbalken stabilisierte Bundstreben. Kopfzonig tragen sie ein Firsträhm, an dessen Enden die Anfallspunkte zweier giebelseitigen Vollwalmflächen ansetzten. Neben dem Firsträhm erfolgt die Verbindung zwischen den Bundstreben durch zwei, auf halber Dachhöhe angeordnete, die Bundstreben überquerende Längsriegel. Zusammen mit dem Firsträhm und den sich dachhoch überkreuzenden Gefügehölzern übernehmen sie nicht nur die Längsaussteifung des Gesamtdaches, sie tragen auch die dachhauttragenden Hölzer.
Die dem Kerndach zugehörigen Hölzer sind rauchschwarz und deuten einen ehemals schornsteinlosen Rauchabzug an.