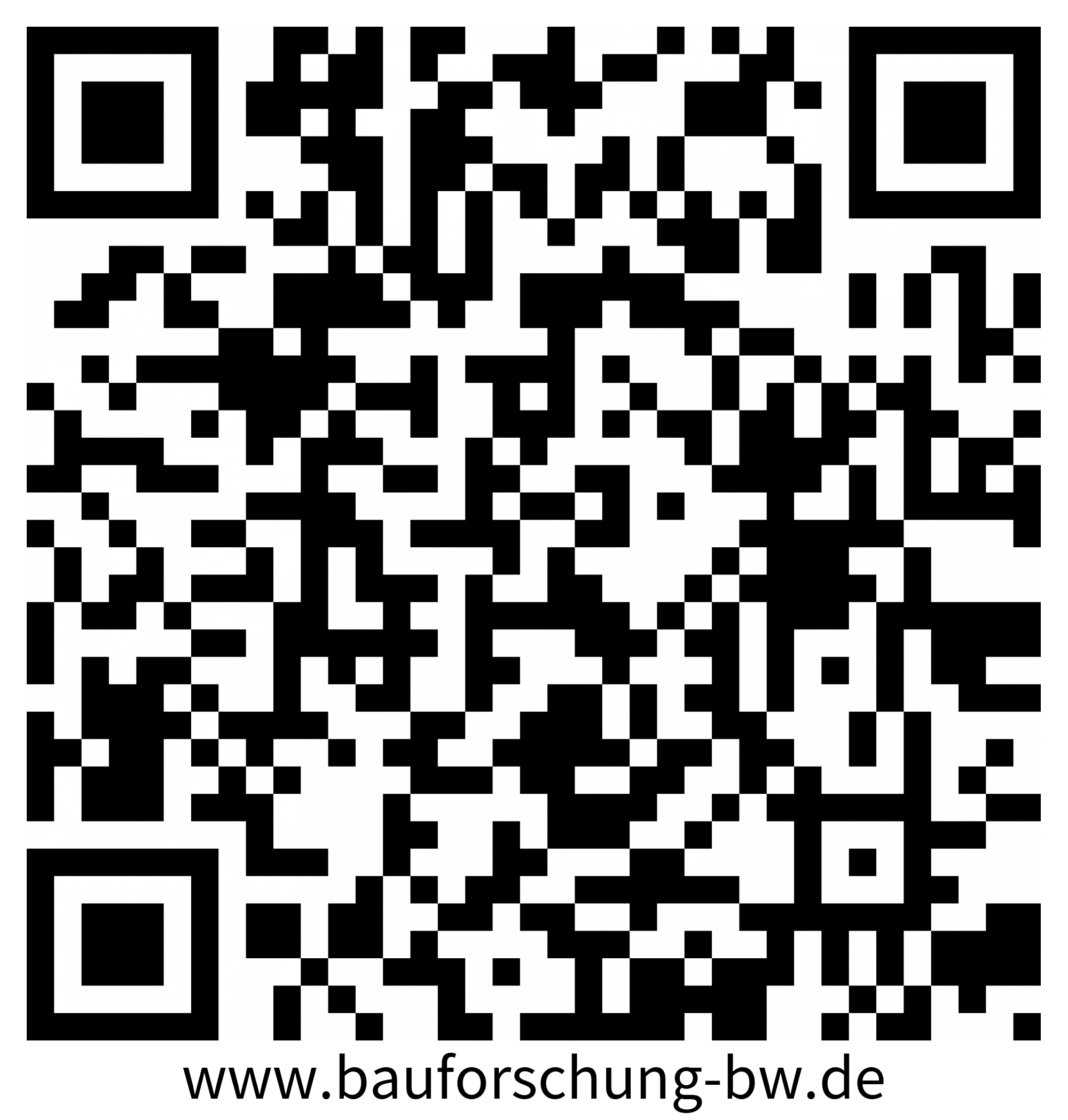Schloss Kirchberg an der Jagst
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Schloßstraße |
| Hausnummer: | 16 |
| Postleitzahl: | 74592 |
| Stadt-Teilort: | Kirchberg an der Jagst |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Schwäbisch Hall (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8127046010 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Objektbeziehungen
| Ist Gebäudeteil von: | |
| keine Angabe | |
|
|
|
| Besteht aus folgenden Gebäudeteilen: | |
| 1. Beinhaltet Bauteil: | Schloss Kirchberg an der Jagst, Marstall, Schloßstraße 16 |
| 2. Beinhaltet Bauteil: | Schloss Kirchberg an der Jagst, Witwenbau, Schloßstraße 16 |
Schloss Kirchberg an der Jagst, Witwenbau, Schloßstraße 16 (74592 Kirchberg an der Jagst)
Bauphasen
Die heutige Schlossanlage geht auf eine Burg zurück, die noch in staufischer Zeit unter den Herren von Sulz zum Schutz der Transitstraße zwischen Hall und Rothenburg errichtet worden war. Zu den Ursprüngen der Burg Kirchberg liegen aber keine gesicherten Erkenntnisse vor. Allgemein gilt, dass um 950 eine Kapelle auf dem Bergsporn errichtet wurde, die dem Berg seinen Namen gab. Ab dem 13. Jahrhundert sind die Herren von Kirchberg nachweisbar, die wohl aus der Familie von Sulz hervorgegangen waren. Ihre Stammburg lag auf einem Bergsporn nördlich der Jagst, gegenüber von Kirchberg. Der Baubefund legt tatsächlich nahe, dass spätestens ab der Mitte des 13. Jahrhunderts eine Burg existierte.
Im Jahr 1313 übertrug der Bischof von Würzburg das „castrum Kirchberg“, ein Hochstiftslehen, an die Herren von Hohenlohe und 1373 stattete Kaiser Karl IV. den Burgweiler mit den Rechten und Privilegien einer Stadt aus. Dies beinhaltete, unter anderen, die Möglichkeit die Stadt zu befestigen.
Bis 1384 war das Lehen im Besitz der Hohenlohe, als sie sich gezwungen sahen, dieses an die Reichsstädte Rothenburg, Dinkelsbühl und Hall zu verpfänden. 1398 erfolgte dann der Verkauf von Stadt und Burg Kirchberg neben zahlreichen weiteren Gütern an die Gläubiger.
Unter den neuen Eigentümern erfolgte der festungsmäßige Ausbau von Stadt und Burg auf dem Kirchberg. Etwa in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts war die Ringmauer geschlossen, während sich der Bau des Zwingers noch bis weit in die erste Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts zog. Von Interesse ist darunter vor allem der trapezförmige Bezirk vor der Burg, der Bereich des heutigen Ehrenhofes, die sog. Schütt. Sie reichte einst bis zu einer natürlichen Verwerfungsspalte im Gelände, die man zu jener Zeit künstlich steiler machte.
Von der schildmauerartigen Stadtbefestigung sind bis heute Teile erhalten, darunter ein Turm in der Südostecke und der anschließende Torbau, nunmehr im barocken Kleid, der heute die Ortseinfahrt der Stadt verkörpert.
Nachdem Johann Kasimir von Hohenlohe aus der Neuensteiner Hauptlinie das Amt Kirchberg 1562 zurückerwarb, wurde die einst vollständig in das Verteidigungssystem integrierte Burg hingegen durch den Ausbau zur repräsentativen Schlossanlage im ausgehenden sechzehnten Jahrhundert sukzessive abgebrochen.
Neben dem Halsgraben vor der Schlossfront, dessen innere Mauer noch Schießscharten aus spätmittelalterlicher Zeit aufweist, zählen gewiss weite Teile der Fundamente, sowohl im Bereich des Kernbaus als auch unterhalb der Flügelbauten, und nicht zuletzt der quadratische Wehrturm in der Nordostecke sowie der sogenannte „Schindengaul“ zum mittelalterlichen Bestand. Letzterer meint eine ehemalige Bastion, die seinerzeit den hinteren Schlosshofes umfasste.
Ab 1590 entwickelte sich Kirchberg zum Mittelpunkt eines großen hohenloheschen Amtsbezirkes. Damit verbunden war der Umbau zur Residenz und der Ausbau der vorhandenen Wehranlage seitens der gräflichen Familie, die folglich vorsah hier einen ständigen Sitz zu haben. Letzteres beinhaltete die Aufführung der beiden Eckbasteien und des vorderen Querbaus, nachdem der Altbaubestand vollständig abgebrochen worden war, einerseits, die Verbreiterung und Vertiefung der beiden Längsgräben und des Halsgrabens andererseits. Im Stil der deutschen Renaissance entstand in den folgenden sieben Jahren eine zeitgenössisch moderne, annähernd regelmäßige Vierflügelanlage, für die französische und niederländische Architekturen vorbildhaft waren. Die geschlossene, wehrhafte Kubatur und die zeittypischen Schweifgiebel, wie sie noch heute den hinteren Querbau zieren, dominieren die Talansicht auf das Schloss bis heute.
Einen Eindruck von Schloss und Stadt zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, vor der letzten großen und weitreichenden Baumaßnahem, vermag neben dem Fassadenriss von Leopoldo Retti (HZAN, GA 115 III/368) das Titelblatt einer Leichenpredigt aus dem Jahr 1706 (HZAN, GA 115 III/23), ein Ölgemälde, entstanden um 1745, und die Rötelzeichnung von Johann Justus Preißler zu geben.
Seit 1699 war das Schloss Sitz der neuen Linie Hohenlohe-Kirchberg, und die Baulust gleich ihres ersten Vertreters, Graf Friedrich Eberhard, gab den Anstoß für die letzten tiefgreifenden Erneuerungen und Erweiterungsmaßnahmen. Sie betrafen die gesamte Anlage und sind demnach für ihre heutige Gestalt maßgeblich verantwortlich. Der Anteil Friedrich Eberhards beschränkte sich jedoch auf die Neugestaltung der Innenräume, und es oblag seinem Sohn, dem späteren Fürst Karl August, den Umbau des Renaissanceschlosses zur barocken Residenz voranzutreiben.
Noch im Todesjahr des Vaters 1737 wendete sich Karl August mit dem Entwurfsauftrag an den Ingenieur-Capitän und Hofbaumeister des benachbarten markgräflichen Hofes in Ansbach, den späteren Oberbaudirektor des Stuttgarter Residenzschlosses Leopoldo Retti [1704-1751]. Seine Pläne beinhalteten, zusammengefasst, erstens die Erweiterung des Renaissanceschlosses vor dem Halsgraben, im Bereich des zu diesem Zweck niedergelegten Vorwerks, der Schütt, um einen Marstall und einen Witwenbau nebst „Anbäulein“ [zit. n. Retti] und Wachhaus. Die baugleichen Flügel flankieren dabei einen neu ausgestalteten Ehrenhof spiegelbildlich entlang der Hangseiten. Das anfänglich verbindende Element zwischen altem und dem neuem Schloss stellten schmale, eingeschossige Kommunikationsgänge aus Holz auf Höhe des ersten Obergeschosses. Zweitens den Neubau der inneren Schlossgrabenbrücke. Drittens erfolgte der Abbruch des alten, westlichen Zwerchflügels der Kernanlage und sein Neubau gemäß dem ebenfalls neu gestalteten Zwerchflügel im Osten.
Zur Ausführung kam ab 1738 eine deutlich reduzierte Variante der Retti’schen Entwürfe, was die Forschung weitgehend einhellig mit Kosten- und pietistischen Gründen erklärt. Betrachtet man jedoch den zur Verfügung stehenden Platz auf dem schmalen Höhenrücken, und begrenzt im Südwesten durch die städtische Bebauung, wird schnell klar, dass die Vorstellungen des Architekten in Bezug auf die Längsausdehnung im Grunde utopisch waren; die zurückhaltende, fast schon klassizistische Fassadengestalt hingegen entspricht, von Details wie den Balkonen abgesehen, seinen Vorgaben und dabei nicht zuletzt den seinerzeit maßgebenden französischen Stilvorgaben. Im Jahr 1745 war das Gros der Arbeiten an den Flügelbauten abgeschlossen.
Mit der barocken Umgestaltung verlor die Anlage sukzessive noch die letzten verbliebenen Reste ihres fortifikatorischen Charakters. Dass der Ehrenhof gegen die Stadt bis heute dennoch verschlossen ist, vermag die geographisch bedingte, ungewöhnliche Nähe der Stadt Kirchberg zum Schlossbestand begründet haben. In Anbetracht weiterer zeitgenössischer Schlösser, gedacht ist an vergleichbar kleine Architekturen aus Unterfranken, stellt dieser Umstand allerdings keine Seltenheit dar. Und dennoch, die Tendenz zur steten Entfestigung der Kirchberger Anlage bekräftigt die ab 1761 außerhalb von Schloss- und Stadtmauer angelegte Parkanlage, der „Neue Weg“, dessen Gestaltung um 1785 zum Abschluss kam.
Im Jahr 1861 erlosch die Linie der Grafen von Hohenlohe-Kirchberg. Sie hatten das Schloss ununterbrochen als ständigen Sitz genutzt, das nun in den Besitz des Fürstenhauses Hohenlohe-Öhringen überging.
Bis 1945 geschah seit den barocken Umbaumaßnahmen an Schloss und Gärten nichts Nennenswertes; im Gegenteil, mit dem Besitzerwechsel stand der Kernbau der Schlossanlage sogar größtenteils leer. Die Flügelbauten hingegen waren seit 1919 von der 1914 gegründeten und im benachbarten Eberhardsbau ansässigen städtischen Reformschule [kurz: Schlossschule Kirchberg] zu Internatszwecken angemietet worden. Sie verließ das Gelände 1964 endgültig.
Unmittelbar nach Kriegsende diente das Schloss ganz unterschiedlichen Zwecken: u.a. als Quartier amerikanischer Soldaten und Durchgangslager ehemaliger Zwangsarbeiter. 1946 beschlagnahmte es dann das Stuttgarter Innenministerium und beauftragte den Landesverband der Inneren Mission von Württemberg, darin ein „Altenheim für Ostflüchtlinge“ einzurichten. 1952 gingen die historischen Räume an die im selben Jahr gegründete Evangelische Heimstiftung in Stuttgart. Sie ist bis heute Besitzerin und Hausherrin der Schlossanlage und nutzt aktuell die beiden Flügelbauten sowie die unmittelbar anschließenden Trakte im Bereich der Wohnbasteien zum Zweck der Altenpflege.
Mit dem Ende der herrschaftlichen Nutzung waren, so der Forschungsstand, zunächst keine Folgen für die bauliche Substanz der Schlossanlage verbunden. Vielmehr führte Schloss Kirchberg innerhalb der hohenloheschen Residenzen ein Schattendasein. Ein Interesse bestand einzig an der beweglichen Ausstattung, deren Gros sukzessive nach Neuenstein geschafft worden war, wo sie sich noch heute befindet, untergebracht zum Teil im Schlossmuseum.
Dennoch bedingte die langjährige Nutzung des Schlosses zunächst als Internat und Schule, mitunter als Flüchtlingslager und letztlich als Altenheim spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg tiefgreifende Umbaumaßnahmen. Für die Flügelbauten bedeutete das in erster Linie die Abkehr von der bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein überkommenen bauzeitlichen Binnengliederung, und, damit einhergehend, der Verlust der originären Ausstattung. Gemeint sind Böden, Kamine und Öfen, vor allem aber das Stuckwerk, dessen heute noch vorhandener Bestand, aus der Bauzeit und der Zeit des Biedermeier (gk, s), immerhin zwei historische Bauphasen zu belegen vermögen.
(1240 - 1400)
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Burg, allgemein
- Sakralbauten
- Kapelle, allgemein
- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein
- Buckelquader
(1373)
(1590 - 1597)
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
- Schloss
(1699 - 1861)
(1738 - 1745)
Der Witwenbau wurde zwischen 1738-1739, der Marstall zwischen 1738/41-1745 erbaut (a).

- Dachgeschoss(e)
- Anbau
- Schlossanlage
- allgemein
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Torhaus
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
- Marstall
- Dachform
- Mansardwalmdach
(1739 - 1744)
(1743 - 1744)
(1744)
Eine Inschrifttafel erklärt dort den barocken Bauhergang oberhalb des Portals wie folgt (i):
DIRVTO PROPVGNACVLO, QVO HAEC MRX [sic: ARX] AB ANTERIORI PARTE OBVAL= / LABATVR, COMPLETAQUE FOSSA, ILLVD AP [sic: AD] VNO LATERE CIRCVMDANTE SPATIO / INDE EFFECTO SPLEN=DIDA DVO AEDIFICIA, / QVOPVM ALTERVM AD SERENIS: VIDVAE, ALTE= / RUM AD AMPLIOREM CELSIS: FAMILIAE HABI= / TATIONEM DESTINABATVR FVNDITVS IN AEDIFICANDA. / PONTEM HVNC LAPIDEVM, LIGNEO ABRVPTO EXSTRVEN= / DVM, PORTAMQUE HANC IN JV=STUM ORDINEM REDACTAM, EXOR= / NANDAM CVRAVIT, ET TOTVM INGENS HOC OPVS MDCCXXXVIII / INCHOATVM, DIVINA FAVENTE GRATIA FELI= / CITER ABSOL=VIT A・R・S ・/ MDCCXLV CELS: COMES ・
(1745)
(1756)
(1764 - 1765)
(1767)
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
- Burg, allgemein
(1919 - 1964)
- Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
- Schule, Kindergarten
(1928)

- Erdgeschoss
- Anlagen für Erholung, Freizeit, Sport
- Sportanlage
(1946 - 2012)
- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
- Altenwohnheim, Pflegeheim
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Versammlungsstätte
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Untersuchung der barocken Flügelbauten (Marstall und Witwenbau)
- Bauhistorische Untersuchung Hauptbau
- Restauratorische Untersuchung Witwenbau und Marstall
Beschreibung
Kirchberg an der Jagst, von Merian als ein „Städtlein und Schloß / zwischen Rotenburg und Schwäbischen-Halle/ von jedem Ort dritthalb Meilen gelegen […]“ (Matthäus Merian (Hg.): Topographia Franconiae, Frankfurt am Main 1648, 51) beschrieben, liegt in etwa auf halbem Weg zwischen den beiden ehemaligen Reichsstädten, der heutigen Kreisstadt Schwäbisch Hall und Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach). Auf dem Plateau eines Höhenrückens, oberhalb einer Jagstfurt, wo die Hohenloher auf die Haller Ebene trifft, befindet sich die Stadt Kirchberg, ein ehemaliger Burgweiler. Die zugehörige Höhenburg, die man zugunsten des heutigen Schlosses frühzeitig schleifte, diente einst, gemeinsam mit den benachbarten Burgen Sulz (1525 zerstört) und Hornberg, zur Sicherung der genannten Furt und der durch die sogenannte Steinbachklinge führenden reichsstädtischen Transitstraße.
Wehrtechnisch günstig errichtete man die Festung an der Spitze des Bergsporns im Nordwesten, wo die Steilhänge bis zu fünfzig Meter hoch aufragen. Auf diese Weise war der Baubestand von den Felshängen zu drei Seiten und dem Fluss am Fuße bereits sehr gut geschützt und stellte noch dazu einen idealen Zufluchtsort. Bis ins achtzehnte Jahrhundert trennten sie von der einzigen Angriffsseite im Südwesten, gegen das Plateau, auf dem sich die Stadt Kirchberg befindet, zwei Quergräben und ein Vorwerk. Von der ehemaligen Bastion zeugt augenfällig nur noch der circa zwölf Meter breite und zweiundachtzig Meter lange Halsgraben, der den Kernbau von den barocken Flügelgebäuden trennt. Das Vorwerk hingegen, der Bereich der sog. „Schütt“ wurde zugunsten des äußeren Schlosshofes aufgegeben.
- Schlossanlage
- allgemein
- Siedlung
- Stadt
- Residenz- und Hofhaltungsbauten
- Schloss
Zonierung:
Die Vierflügelanlage entspricht in ihrer Ausdehnung dem Renaissancebau. Von diesem zeugen vor allem noch der nördliche und die beiden seitlichen Zwerchflügel, auch wenn der südliche im 18. Jahrhundert im Bereich des Daches tiefgreifend verändert wurde.
Der Kernbau des Schlosses dient heute als Werkstatt zahlreicher Künstler, die dort zugleich auch ihre Ateliers eingerichtet haben. Daher sind viele Bereiche der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die übrigen jedoch, darunter der Rittersaal oder die Räumlichkeiten des ehemalige Raritätenkabinetts, ein polygonaler Saal über dem ehem. Bastionsturm im NW, werden museal genutzt.
Konstruktionen
- Steinbau Mauerwerk
- Backstein
- Bruchstein
- Buckelquader
- Großquader
- Decken
- Balken-Bretter-Decke
- Lehmwickeldecke
- Gewölbe
- Kreuzgratgewölbe
- Tonnengewölbe
- Dachform
- Mansardwalmdach
- Satteldach
- Satteldach mit einseitigem Vollwalm
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Gestaltungselemente
- Schweifgiebel
- Zierglieder im Steinbau
- Detail (Ausstattung)
- bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
- besondere Bodenbeläge
- Portikus
- Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
- Backstein/Lehmziegel
- Flechtwerk
- Lehmwickel









![Johann, Krieg, Riss von Kirchberg (Ausschnitt Bergsporn mit Schlossanlage), 1747 [Reproduktion] / Schloss Kirchberg an der Jagst in 74592 Kirchberg an der Jagst (01.01.1747 - Reproduktion im Rathaus Kirchberg) Johann, Krieg, Riss von Kirchberg (Ausschnitt Bergsporn mit Schlossanlage), 1747 [Reproduktion] / Schloss Kirchberg an der Jagst in 74592 Kirchberg an der Jagst (01.01.1747 - Reproduktion im Rathaus Kirchberg)](https://www.restaurierung-bw.de/img/xshared/objekt/8696/2183_200x133_1327924363.jpeg)