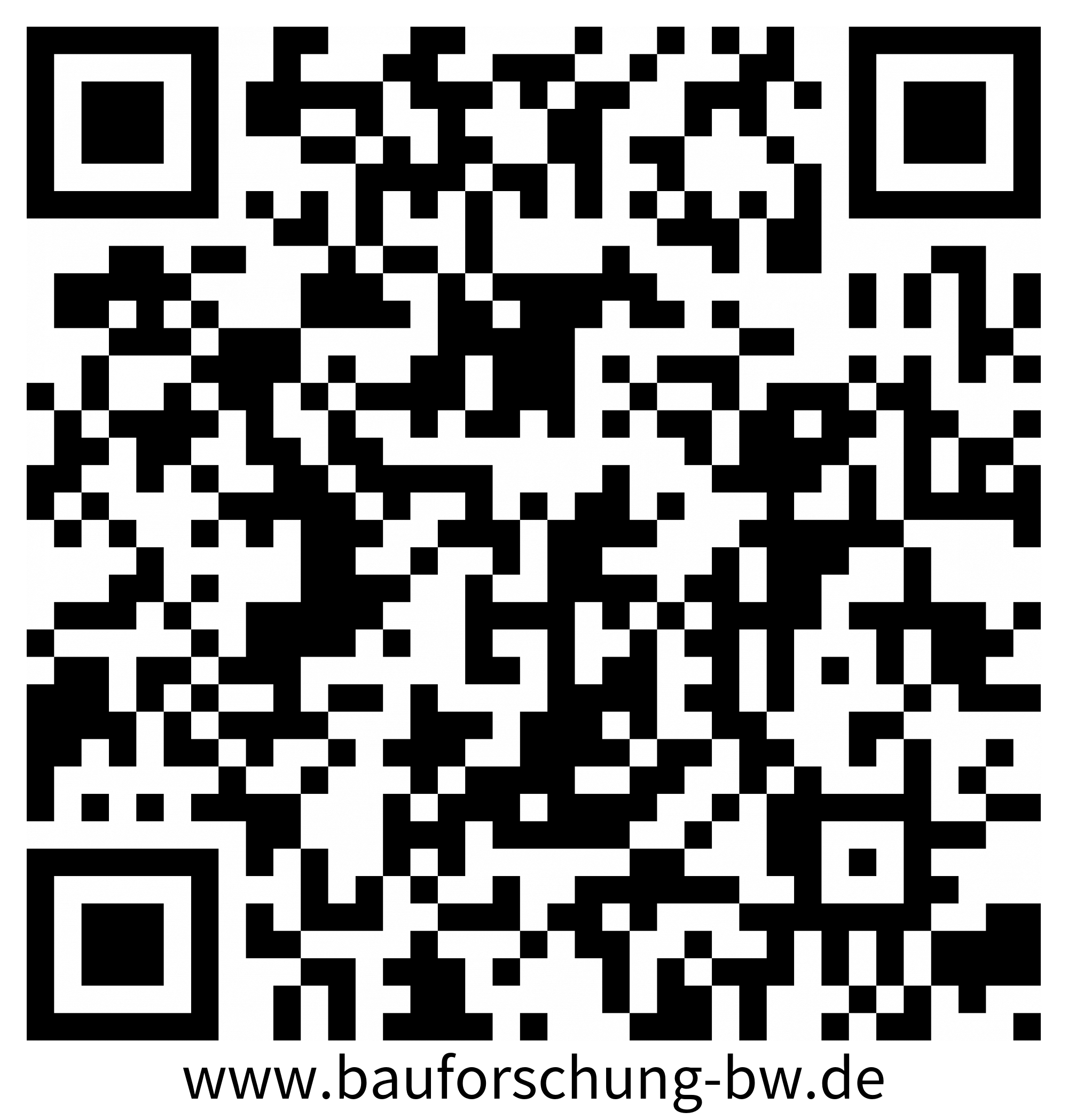Untere Kelter
ID:
181710238119
/
Datum:
10.04.2025
Datenbestand: Bauforschung
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Schloßgasse |
| Hausnummer: | 21 |
| Postleitzahl: | 71706 |
| Stadt-Teilort: | Markgröningen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ludwigsburg (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8118050007 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Alte Lateinschule, Kirchplatz 2 (71706 Markgröningen)
Sog. Alte Sakristei, Kirchplatz 7 ( 71706 Markgröningen)
Evangel. Pfarrhaus, Kirchplatz 9 (71706 Markgröningen)
Scheunengebäude. (71706 Markgröningen, Ostergasse 1a)
Keller Scheunengebäude. (71706 Markgröningen, Ostergasse 7/1-2)
Ehem. Landesfruchtkasten, Schlossgasse 23 (71706 Markgröningen)
Heilig-Geist-Spital (71706 Markgröningen, Spital 1)
Sog. Alte Sakristei, Kirchplatz 7 ( 71706 Markgröningen)
Evangel. Pfarrhaus, Kirchplatz 9 (71706 Markgröningen)
Scheunengebäude. (71706 Markgröningen, Ostergasse 1a)
Keller Scheunengebäude. (71706 Markgröningen, Ostergasse 7/1-2)
Ehem. Landesfruchtkasten, Schlossgasse 23 (71706 Markgröningen)
Heilig-Geist-Spital (71706 Markgröningen, Spital 1)
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Die Untere Kelter wurde im 16. Jahrhundert als Kelter und Zehntscheune errichtet. Der Umbau für die städtische Verwaltung erfolgte ab den 1960er Jahren.
1. Bauphase:
(1559 - 1560)
(1559 - 1560)
Erbauung des Gebäudes
Durch die Archivforschung des Arbeitskreises für Geschichtsforschung und Denkmalpflege Markgröningen e.V. (AGD Markgröningen) wurde die Erbauungszeit der heute bestehenden Unteren Kelter nach 1559 eingegrenzt. Die Publikationen des Vereins dokumentieren eine Kaufurkunde von 1559 für das Grundstück der Unteren Kelter. Die Ergebnisse der dendrochronologischen Beprobung belegen das Fälldatum der Hölzer 1559/1560 (d).
Durch die Archivforschung des Arbeitskreises für Geschichtsforschung und Denkmalpflege Markgröningen e.V. (AGD Markgröningen) wurde die Erbauungszeit der heute bestehenden Unteren Kelter nach 1559 eingegrenzt. Die Publikationen des Vereins dokumentieren eine Kaufurkunde von 1559 für das Grundstück der Unteren Kelter. Die Ergebnisse der dendrochronologischen Beprobung belegen das Fälldatum der Hölzer 1559/1560 (d).
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Kelter/ Trotte/ Torkel
- Zehntscheune
2. Bauphase:
(1828)
(1828)
Im Jahr 1828 erwarb die Stadt die Keltereinrichtung und das Kelterrecht.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Untergeschoss(e)
3. Bauphase:
(1924)
(1924)
Im Jahr 1924 erwirbt die Stadt das gesamte Gebäude.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
4. Bauphase:
(1946)
(1946)
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollte die Kelter für Flüchtlingsunterkünfte teilweise umgebaut werden. Die Bauunterlagen dokumentieren ein Baugesuch für den Einbau von Wohnungen im 1. Stock (Obergeschoss). Der „östliche Saal“ wird zu Wohnungen neu genutzt. Der Baugesuchsplan zeigt den Einbau von acht Räumen, Kaminen zur Beheizung der Räume und Reparaturen im Bereich des Bodens. Weitere Umbauten erfolgen im Bereich der Treppe, die aus brandschutztechnischen Gründen verbreitert werden sollte. Anhand des Baugesuchs ist dokumentiert, wie die ehemalige Erschließung des Ober- und Dachgeschosses erfolgte. Die bauzeitliche Erschließung erfolgte im Innenraum. Durch die Tore gelangte man in das Erdgeschoss, in dem Treppenstiegen in die oberen Geschosse führten. Laut Plan waren diese mittig gelegen. Es handelte sich um einläufige Treppen, die in einem Flurbereich aneinander angeschlossen waren und die Geschosse verbanden.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
5. Bauphase:
(1960 - 1967)
(1960 - 1967)
Der maßgebliche Umbau des Gebäudes erfolgte ab 1960 mit dem Einzug des städtischen Notariats, des Bauamtes und der Weinbaugenossenschaft. Ausbau von Ober- und Dachgeschoss zu Wohn- und Bürozwecken. Einbau des heutigen Haupttreppenhauses auf der Nordseite. Einbau von Veranstaltungsräumen im EG.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
Bauwerkstyp:
- Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen
- Amtsgebäude
6. Bauphase:
(1972 - 1973)
(1972 - 1973)
Im Jahr 1972 wurden weitere Büroräume im Dachgeschoss ergänzt, da durch die Eingemeindung von Unterriexingen die Verwaltung vergrößert werden musste.
Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)
7. Bauphase:
(1991 - 1994)
(1991 - 1994)
Eine weitere Umbauphase erfolgte 1991. Das Baugesuch dokumentiert den vollständigen Ausbau der Dachgeschosse zu Bürozwecken. Ausbau des 2. Dachgeschoss zu Besprechungs- und Archivräumen.
Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)
Zugeordnete Dokumentationen
- Dendrochronologische Untersuchung
- Bauaufnahme
- Fassaden Bildpläne
- Baualterskartierung
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Die ehemalige Untere Kelter liegt direkt in der Altstadt von Markgröningen. Nordwestlich des zentralen Marktplatzes steht das Gebäude in einem engen Zusammenschluss mit der Oberen Kelter, der ehemaligen Zehntscheuer und dem ehemaligen Fruchtkasten zwischen dem ehemaligen Schloss und dem Rathaus der Stadt. Die direkte Lage zu den für die Stadtstruktur wichtigen Gebäuden zeigt auch nach der Nutzungsaufgabe die ehemals wichtige Rolle des imposanten steinernen Gebäudes. Der Stadtkern von Markgröningen steht seit 1984 als Gesamtanlage gemäß § 19 DSchG unter Denkmalschutz. Die Untere Kelter ist gemäß § 2 DSchG als Kulturdenkmal ausgewiesen.
Lagedetail:
- Siedlung
- Stadt
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Kelter/ Trotte/ Torkel
- Zehntscheune
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Es handelt sich um einen zweigeschossigen Massivbau auf rechteckigem Grundriss. Die Vollgeschosse sind umlaufend mit Fenster- oder Türöffnungen strukturiert. Den Abschluss bildet ein Satteldach mit beidseitigem Halbwalm und mit durchgehenden Schleppgauben auf den Längsseiten. Die Giebelwände unterhalb des Halbwalms sind versteinert und ebenfalls mit Fensteröffnungen strukturiert.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
Erdgeschoss
Das Erdgeschoss wird über die Nordseite über zwei große rundbogige Tore erschlossen. Der ehemalige Kelterraum ist bis heute weitgehend ungeteilt, sowie es die frühere Nutzung und das Einstellen der ehemaligen Kelterbäume notwendig machte. Das Gebäude wird durch die massiven Umfassungsmauern und zwei parallele Stützenreihen in drei Längszonen gegliedert. In Querrichtung wird der Raum durch die sechs paarweise angeordneten Stützen in insgesamt sieben Zonen gegliedert. Eine Belichtung des Geschosses erfolgt durch die annähernd symmetrische Anordnung von meist rundbogigen Fenstern an allen vier Außenwänden. In der nördlichen Längszone befindet sich das Haupttreppenhaus in die oberen Geschosse der Kelter.
Obergeschoss
Das Obergeschoss ist wie das Erdgeschoss ebenfalls ein Vollgeschoss, mit massiven Umfassungsmauern und einer umlaufenden, annähernd symmetrischen Belichtung durch Fensteröffnungen. Auch hier ergibt sich durch die vorhandene Stützenstellung die Aufteilung des Grundrisses in drei Längszonen. In der mittleren Längszone liegen mittig zwei Flurabschnitte, Sanitärräume und westlich ein Büro- und Besprechungsraum. Die nördliche und südliche Längszone sind in Büroräume unterteilt, wobei die nördliche Längszone durch das mittig liegende Treppenhaus unterbrochen wird.
Dachgeschoss 1
Das Dachgeschoss ist durch den Dachausbau mit durchgängigen Schleppgauben an der Nord- und Südseite annähernd als Vollgeschoss ausgebaut. Es ist ähnlich gegliedert wie das darunterliegende Obergeschoss. Mittig befindet sich eine Flurzone, die an der westlichen und östlichen Stirnseite mit Sanitärräumen abschließt. In der nördlichen und südlichen Längszone befinden sich Büroräume, Teeküche, Archiv, Kopierraum sowie im Norden das Treppenhaus.
Kellergeschoss
Der Gewölbekeller verläuft über die gesamte Gebäudelänge der Unteren Kelter. Die Kellerräume sind mit einem Tonnengewölbe in Längsrichtung überwölbt, das auf halber Länge in Querrichtung durch den Treppenabgang unterbrochen wird. Der Kellerzugang erfolgt von außen auf der Nordseite des Keltergebäudes. In den Umfassungswänden sind jeweils paarweise gegenüberliegend insgesamt 10 Schächte vorhanden, die angeschrägt bis oberhalb des anstehenden Erdreiches führen. Auf Höhe des Erdgeschosses finden sich rundbogige Öffnungen, die zur Belichtung und Belüftung des Kellerraumes dienten. Die meisten Öffnungen sind mit einem Gitter und einem hölzernen Laden verschlossen.
Das Erdgeschoss wird über die Nordseite über zwei große rundbogige Tore erschlossen. Der ehemalige Kelterraum ist bis heute weitgehend ungeteilt, sowie es die frühere Nutzung und das Einstellen der ehemaligen Kelterbäume notwendig machte. Das Gebäude wird durch die massiven Umfassungsmauern und zwei parallele Stützenreihen in drei Längszonen gegliedert. In Querrichtung wird der Raum durch die sechs paarweise angeordneten Stützen in insgesamt sieben Zonen gegliedert. Eine Belichtung des Geschosses erfolgt durch die annähernd symmetrische Anordnung von meist rundbogigen Fenstern an allen vier Außenwänden. In der nördlichen Längszone befindet sich das Haupttreppenhaus in die oberen Geschosse der Kelter.
Obergeschoss
Das Obergeschoss ist wie das Erdgeschoss ebenfalls ein Vollgeschoss, mit massiven Umfassungsmauern und einer umlaufenden, annähernd symmetrischen Belichtung durch Fensteröffnungen. Auch hier ergibt sich durch die vorhandene Stützenstellung die Aufteilung des Grundrisses in drei Längszonen. In der mittleren Längszone liegen mittig zwei Flurabschnitte, Sanitärräume und westlich ein Büro- und Besprechungsraum. Die nördliche und südliche Längszone sind in Büroräume unterteilt, wobei die nördliche Längszone durch das mittig liegende Treppenhaus unterbrochen wird.
Dachgeschoss 1
Das Dachgeschoss ist durch den Dachausbau mit durchgängigen Schleppgauben an der Nord- und Südseite annähernd als Vollgeschoss ausgebaut. Es ist ähnlich gegliedert wie das darunterliegende Obergeschoss. Mittig befindet sich eine Flurzone, die an der westlichen und östlichen Stirnseite mit Sanitärräumen abschließt. In der nördlichen und südlichen Längszone befinden sich Büroräume, Teeküche, Archiv, Kopierraum sowie im Norden das Treppenhaus.
Kellergeschoss
Der Gewölbekeller verläuft über die gesamte Gebäudelänge der Unteren Kelter. Die Kellerräume sind mit einem Tonnengewölbe in Längsrichtung überwölbt, das auf halber Länge in Querrichtung durch den Treppenabgang unterbrochen wird. Der Kellerzugang erfolgt von außen auf der Nordseite des Keltergebäudes. In den Umfassungswänden sind jeweils paarweise gegenüberliegend insgesamt 10 Schächte vorhanden, die angeschrägt bis oberhalb des anstehenden Erdreiches führen. Auf Höhe des Erdgeschosses finden sich rundbogige Öffnungen, die zur Belichtung und Belüftung des Kellerraumes dienten. Die meisten Öffnungen sind mit einem Gitter und einem hölzernen Laden verschlossen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben
Bestand/Ausstattung:
keine Angaben
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein
- Werkstein
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachform
- Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm
- Schleppgaube(n)
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
- Ständer
- Holzgerüstbau
- allgemein
Konstruktion/Material:
Die Untere Kelter besitzt massive Umfassungswände aus Bruchstein. Die Gebäudeecken sowie die Fenster- und Türöffnungen sind mit Werksteinen hervorgehoben. Die Werksteine aus Sandstein zeigen eine aufwendigere Bearbeitung mit Randschlag und einem abgespitzten Spiegel. Auf einigen Werksteinen finden sich verschiedene Steinmetzzeichen. Diese sind nur indirekt einsehbar, da sie sich überwiegend in den Laibungsinnenflächen der Fenster befinden. Im Bereich der Fenster und Türen sind die Steine innenseitig mit Falz ausgebildet.
Das Untergeschoss ist über die gesamte Länge tonnenförmig überwölbt. Die Bodenbereiche im Erd- und Untergeschoss sind mit einem Estrichboden mit Rollwalzenmuster aus jüngerer Zeit ausgestattet. Die innere Gebäudekonstruktion besteht aus einem Holzgerüst, das sich aus Stützen mit Kopfstreben, Unterzügen und Deckenbalken (Eichen und Nadelholz) zusammensetzt. Die Unterzüge liegen in Längs- und Querrichtung auf den Außenseiten im Mauerwerk zusätzlich auf. Die Stützkonstruktion ist in Erd-, Ober- und 1. Dachgeschoss aufgestellt. Sie besteht aus paarweise aufgestellten Stützenpaaren in unterschiedlicher Anzahl und Ausgestaltung (oktogonale und quadratische Stützquerschnitte, Wulste, Totläufe). Alle Stützen sind in Längs- und Querrichtung mit Kopfstreben zusätzlich ausgesteift und tragen Unterzüge in Längs- und Querrichtung. Darauf sind Deckenbalken aufgelegt. Die Kopfstreben sind nicht vollständig erhalten. Sie wurden stellenweise durch den Einbau von Trennwänden entfernt, stückweise abgeschnitten oder ersetzt. Die bauzeitlichen Kopfstreben weisen eine rundbogige Bearbeitung an der Unterseite auf.
Die innere Struktur des Gebäudes ist maßgeblich auf den Umbau im 20. Jahrhundert zurückzuführen, entsprechend finden sich überwiegend moderne Baumaterialien im Bereich des Treppenhauses und der Büroräume. Das Treppenhaus besitzt eine Grundkonstruktion aus Beton und Mauerwerk aus Hochlochziegeln. Die Treppenläufe sind mit Treppenstufen aus Kunststein, Metallgeländern mit Mipolam-Handläufen ausgestattet. Die Trennwände im Ober- und Dachgeschoss sind überwiegend zwischen die hölzerne Tragwerkskonstruktion eingestellt. Die meisten Trennwände der 1960er Jahre sind aus Porenbetonsteinen („YTONG“, „Schwemmsteine“). Der Ausbau des 2. Dachgeschosses erfolgte mehrheitlich in Holz.
Das Dachtragwerk liegt auf den massiven Außenwänden des Gebäudes auf. Durch die große Gebäudedimension und die daraus resultierenden Spannbreiten in Quer- und Längsrichtung erfolgt eine zusätzliche Abstützung durch mittig paarweise stehende Stützenreihen. Die Stützenpaare finden sich im Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Es handelt sich um ein Sparrendach, in den beiden unteren Ebenen (Dachgeschoss 1 und 2) mit einem eingestellten liegenden Stuhlgerüst in den Bindergespärren. Die Stuhlstreben sind mit drei Kopfstreben in Quer- und Längsrichtung ausgesteift. Stellenweise zeigt sich eine aussteifende Konstruktion/ Windverband, die aus Riegel und Streben besteht. Die Riegel sind zwischen die Stuhlstreben gezapft und die Streben zwischen das Stuhlrähm, die Riegel und vermutlich die Stuhlschwelle. Die Sparren liegen auf der Stuhlkonstruktion und den Windverbänden auf. Im Bereich des Walms ist ein Druckriegel zwischen die äußeren Sparrenpaare gezapft, auf dem ein vertikales Stützholz die Sparren des Walms aufnimmt. Die Holzkonstruktion des Dachtragwerks ist einheitlich mit Zapfenverbindungen konstruiert. Bei der Holzkonstruktion handelt es sich teilweise um Floßholz. Es lassen sich verschiedene Floßspuren im Bereich der Kopfstreben und Deckenbalken finden.
Das Untergeschoss ist über die gesamte Länge tonnenförmig überwölbt. Die Bodenbereiche im Erd- und Untergeschoss sind mit einem Estrichboden mit Rollwalzenmuster aus jüngerer Zeit ausgestattet. Die innere Gebäudekonstruktion besteht aus einem Holzgerüst, das sich aus Stützen mit Kopfstreben, Unterzügen und Deckenbalken (Eichen und Nadelholz) zusammensetzt. Die Unterzüge liegen in Längs- und Querrichtung auf den Außenseiten im Mauerwerk zusätzlich auf. Die Stützkonstruktion ist in Erd-, Ober- und 1. Dachgeschoss aufgestellt. Sie besteht aus paarweise aufgestellten Stützenpaaren in unterschiedlicher Anzahl und Ausgestaltung (oktogonale und quadratische Stützquerschnitte, Wulste, Totläufe). Alle Stützen sind in Längs- und Querrichtung mit Kopfstreben zusätzlich ausgesteift und tragen Unterzüge in Längs- und Querrichtung. Darauf sind Deckenbalken aufgelegt. Die Kopfstreben sind nicht vollständig erhalten. Sie wurden stellenweise durch den Einbau von Trennwänden entfernt, stückweise abgeschnitten oder ersetzt. Die bauzeitlichen Kopfstreben weisen eine rundbogige Bearbeitung an der Unterseite auf.
Die innere Struktur des Gebäudes ist maßgeblich auf den Umbau im 20. Jahrhundert zurückzuführen, entsprechend finden sich überwiegend moderne Baumaterialien im Bereich des Treppenhauses und der Büroräume. Das Treppenhaus besitzt eine Grundkonstruktion aus Beton und Mauerwerk aus Hochlochziegeln. Die Treppenläufe sind mit Treppenstufen aus Kunststein, Metallgeländern mit Mipolam-Handläufen ausgestattet. Die Trennwände im Ober- und Dachgeschoss sind überwiegend zwischen die hölzerne Tragwerkskonstruktion eingestellt. Die meisten Trennwände der 1960er Jahre sind aus Porenbetonsteinen („YTONG“, „Schwemmsteine“). Der Ausbau des 2. Dachgeschosses erfolgte mehrheitlich in Holz.
Das Dachtragwerk liegt auf den massiven Außenwänden des Gebäudes auf. Durch die große Gebäudedimension und die daraus resultierenden Spannbreiten in Quer- und Längsrichtung erfolgt eine zusätzliche Abstützung durch mittig paarweise stehende Stützenreihen. Die Stützenpaare finden sich im Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Es handelt sich um ein Sparrendach, in den beiden unteren Ebenen (Dachgeschoss 1 und 2) mit einem eingestellten liegenden Stuhlgerüst in den Bindergespärren. Die Stuhlstreben sind mit drei Kopfstreben in Quer- und Längsrichtung ausgesteift. Stellenweise zeigt sich eine aussteifende Konstruktion/ Windverband, die aus Riegel und Streben besteht. Die Riegel sind zwischen die Stuhlstreben gezapft und die Streben zwischen das Stuhlrähm, die Riegel und vermutlich die Stuhlschwelle. Die Sparren liegen auf der Stuhlkonstruktion und den Windverbänden auf. Im Bereich des Walms ist ein Druckriegel zwischen die äußeren Sparrenpaare gezapft, auf dem ein vertikales Stützholz die Sparren des Walms aufnimmt. Die Holzkonstruktion des Dachtragwerks ist einheitlich mit Zapfenverbindungen konstruiert. Bei der Holzkonstruktion handelt es sich teilweise um Floßholz. Es lassen sich verschiedene Floßspuren im Bereich der Kopfstreben und Deckenbalken finden.