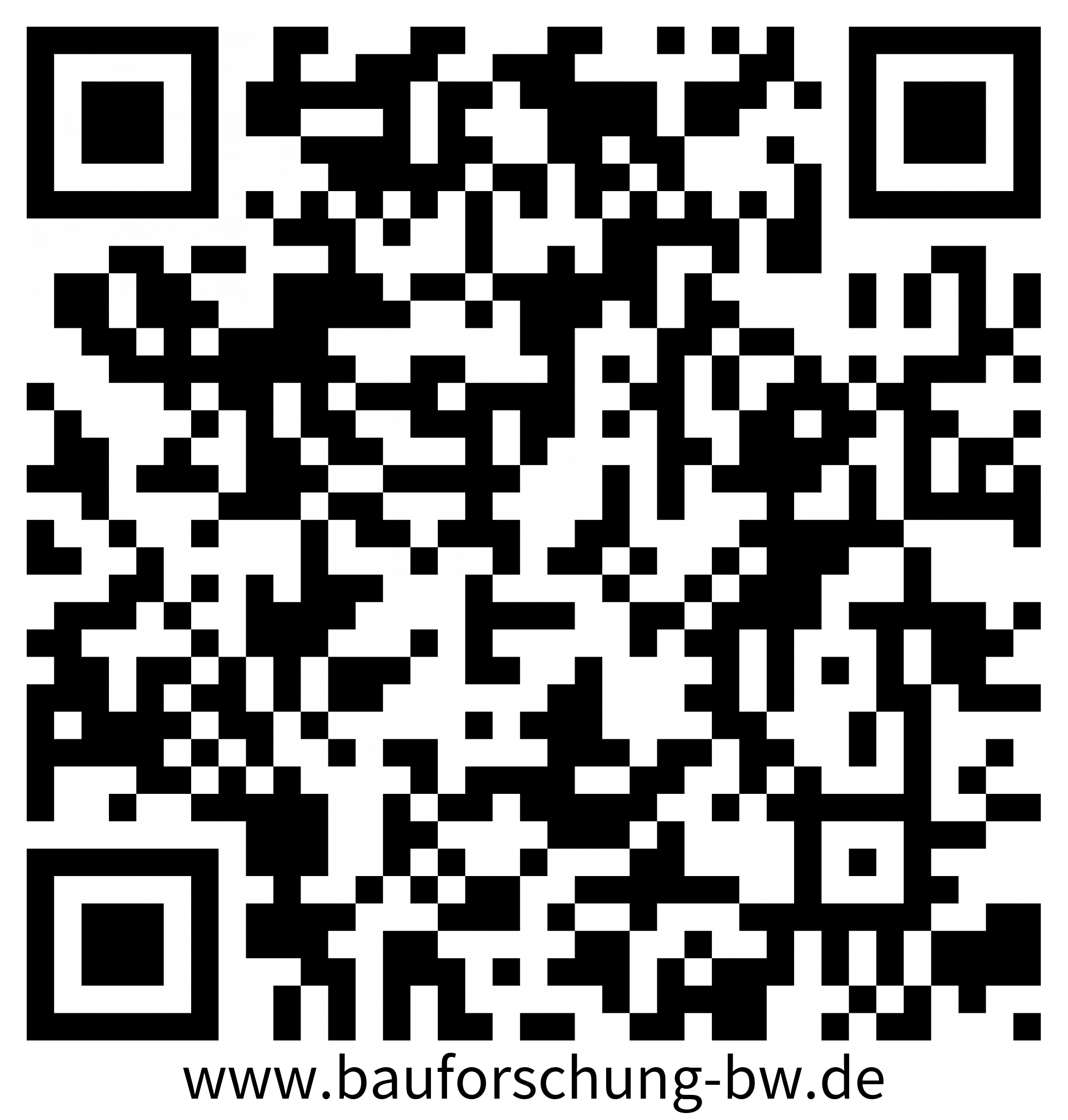Gärtnerhaus
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Eppinger Straße |
| Hausnummer: | 4/1 |
| Postleitzahl: | 75050 |
| Stadt-Teilort: | Gemmingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Heilbronn (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8125034003 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Bauphasen
Wie die dendrochronologische Altersbestimmung belegt, wurde das so genannte Gärtnerhaus in Gemmingen um das Jahr 1817 (d) erbaut. Sehr wahrscheinlich diente es zunächst als reines Ökonomiegebäude (etwa Fruchtkasten, Zehntscheune oder Wagenremise) für das Untere Schloss. Genauere Hinweise auf die ehemalige Nutzung müssten archivalische Forschungen erbringen.
Um 1900 dürfte es zu größeren Umbaumaßnahmen gekommen sein, wobei im Obergeschoss eine Wohnung eingerichtet wurde. Möglicherweise wurde diese für den Schlossgärtner erbaut, so dass von diesem Zeitpunkt an der Name „Gärtnerhaus“ aufkam.
Ab der Mitte bzw. in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Gebäude allmählich für Vereinszwecke umgenutzt. Dabei wurden auch die beiden bestehenden Treppenläufe sowie zahlreiche Innenwände im Erdgeschoss errichtet.
(1817)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Siedlung
- Dorf
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Ökonomiegebäude
(1900)

- Obergeschoss(e)
- Siedlung
- Dorf
(1940 - 1960)

- Erdgeschoss
- Siedlung
- Dorf
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Kurzuntersuchung
Beschreibung
Westlich hinter dem Gärtnerhaus erstreckt sich der Schlosspark, welcher vom Staudbach durchflossen wird.
- Siedlung
- Dorf
Zonierung:
Das Gebäude zeigt eine Untergliederung in sechs Querzonen. Im Erdgeschoss befinden sich drei Längszonen, in den darüberliegenden Geschossen nur zwei Längszonen. Das Erdgeschoss nimmt im wesentlichen Ökonomieräume auf. Die nördliche Querzone hatte ursprünglich eine Stall- oder Lagernutzung. Die zweite Zone von Norden nahm ursprünglich die Vertikalerschließung (Treppe) auf. Die 3. und 4. Zone dienten jeweils als Tenne mit großen Toreinfahrten. Die 5. und 6. Zone nahm einen großen Ökonomieraum auf, welcher durch vier hölzerne Rundsäulen untergliedert war.
Auch im Obergeschoss lässt sich die historische Grundrissgliederung noch nachvollziehen. Diese Ebene diente ursprünglich möglicherweise auch zu Ökonomiezwecken, etwa als Lagerboden für Feldfrüchte. Erst im 19. Jahrhundert dürfte es hier zum Einbau einer Wohnung (wohl Gärtnerwohnung) gekommen sein.
Die Dachgeschosse sind unausgebaut und dienen zu Lagerzwecken
Konstruktionen
- Decken
- Balkendecke
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
- Dachform
- Walmdach
Stuhlstreben des Dachstuhls. Das Dachtragwerk wurde im 1. Dachgeschoss mit einer zweifach
liegenden Stuhlkonstruktion mit mittlerer Stützenreihe errichtet. Die Aussteifung des Dachtragwerks erfolgte in Querrichtung über Kopfstreben zwischen den Stuhlstreben und den Druckriegeln. In Längsrichtung erfolgt die Aussteifung über Fußstreben zwischen den Stuhlstreben und der Stuhlschwelle sowie über Kopfstreben zwischen den Stuhlstreben und dem Stuhlrähm. Im 2. Dachgeschoss befindet sich eine zweifach stehende Stuhlkonstruktion ohne weitere Aussteifungselemente. Abbundzeichen in Form von Dreieckskerben an den Querbundachsen belegen, dass das Dachtragwerk einheitlich und zeitgleich errichtet wurde. Aufgrund der Übereinstimmung der Querbünde am Dachtragwerk mit den Querachsen der beiden Vollgeschosse ist davon auszugehen, dass das gesamte Gebäude zeitgleich errichtet wurde.