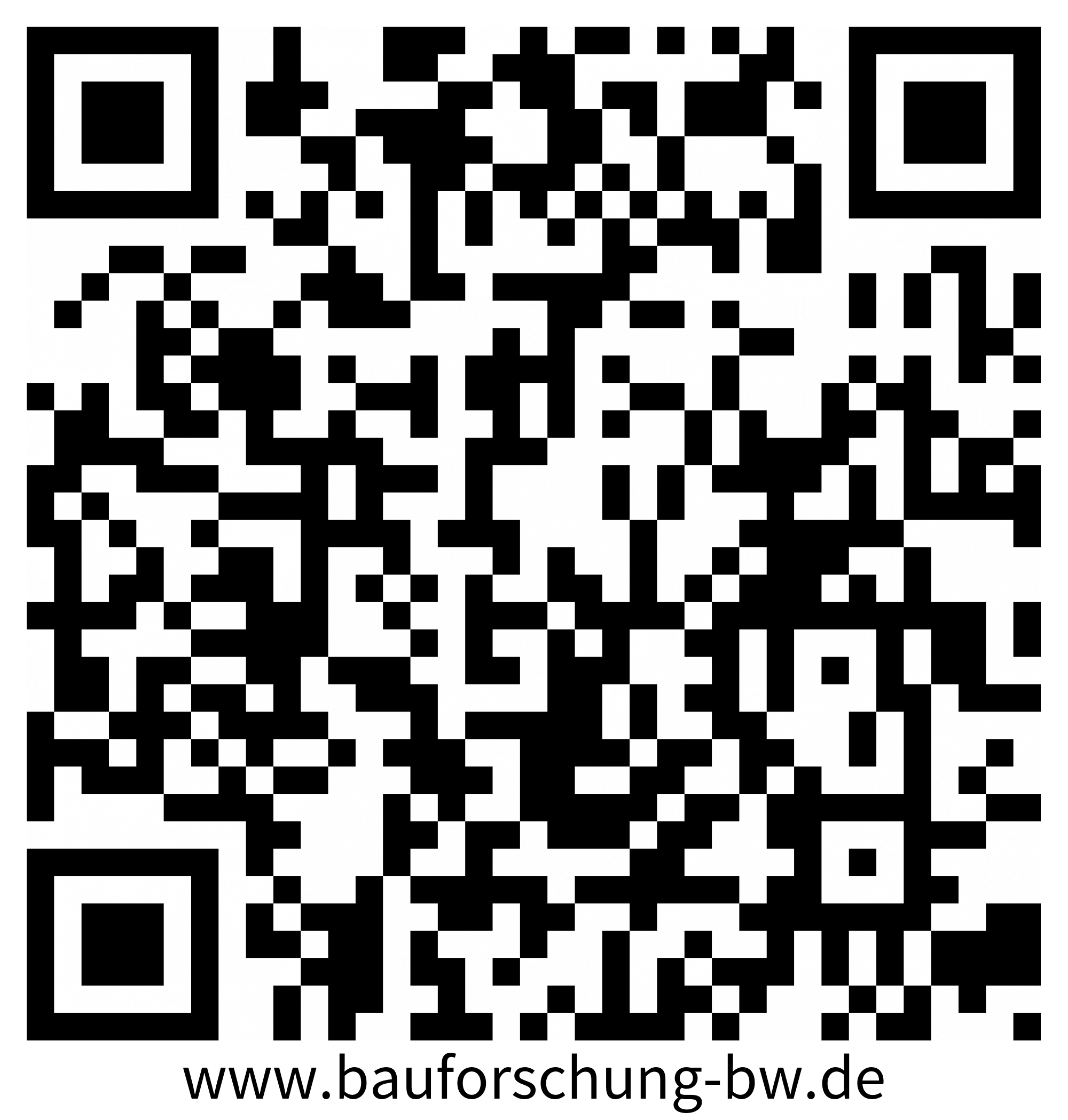Wohnhaus
ID:
117936504114
/
Datum:
10.05.2025
Datenbestand: Bauforschung
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Gartenstraße |
| Hausnummer: | 9 |
| Postleitzahl: | 72660 |
| Stadt-Teilort: | Beuren |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Esslingen (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8116011002 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Dosterhaus, Wohnstallhaus mit Scheuer aus Beuren, Brühlstraße 1 (72660 Beuren)
Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Hauptstraße 10/12 (72660 Beuren)
Einhaus (72660 Beuren, Hauptstraße 28)
Wohnhaus, Hauptstraße 4 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Hauptstraße 6 + 8 (72660 Beuren)
Freilichtmuseum Beuren, In den Herbstwiesen (72660 Beuren)
Wohnhaus, Kelterstraße 2 (72660 Beuren)
Ev. Pfarrkirche St. Nikolaus (72660 Beuren, Linsenhofer Straße 1)
Wohnhaus, Linsenhofer Straße 21 (72660 Beuren)
Wohngebäude, Linsenhofer Straße 35 (72660 Beuren)
sog. Heiligenhaus (72660 Beuren, Owener Straße 7)
Wohn- und Geschäftshaus, Rathausstraße 11/1 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Rathausstraße 11 (72660 Beuren)
Schlegelscheuer aus Beuren, Rathausstraße 1 (72660 Beuren)
Wohnstallhaus, Stocknachstraße 11 (72660 Beuren)
Scheune (abgegangen) (72660 Beuren, Stocknachstraße 8)
Eindachhof, Stocknachstraße 9 (72660 Beuren)
Wohnhaus mit Scheuer, Tiefenbachstraße 2 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Tiefenbachstraße 4 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Tiefenbachstraße 8 (72660 Beuren)
Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Hauptstraße 10/12 (72660 Beuren)
Einhaus (72660 Beuren, Hauptstraße 28)
Wohnhaus, Hauptstraße 4 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Hauptstraße 6 + 8 (72660 Beuren)
Freilichtmuseum Beuren, In den Herbstwiesen (72660 Beuren)
Wohnhaus, Kelterstraße 2 (72660 Beuren)
Ev. Pfarrkirche St. Nikolaus (72660 Beuren, Linsenhofer Straße 1)
Wohnhaus, Linsenhofer Straße 21 (72660 Beuren)
Wohngebäude, Linsenhofer Straße 35 (72660 Beuren)
sog. Heiligenhaus (72660 Beuren, Owener Straße 7)
Wohn- und Geschäftshaus, Rathausstraße 11/1 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Rathausstraße 11 (72660 Beuren)
Schlegelscheuer aus Beuren, Rathausstraße 1 (72660 Beuren)
Wohnstallhaus, Stocknachstraße 11 (72660 Beuren)
Scheune (abgegangen) (72660 Beuren, Stocknachstraße 8)
Eindachhof, Stocknachstraße 9 (72660 Beuren)
Wohnhaus mit Scheuer, Tiefenbachstraße 2 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Tiefenbachstraße 4 (72660 Beuren)
Wohnhaus, Tiefenbachstraße 8 (72660 Beuren)
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Das Gebäude Gartenstraße 9 stammt aus der Zeit um 1466 und wurde über einem älteren Gewölbekeller errichtet. Als Firstständergebäude gehört es zu einem inzwischen sehr seltenen
Vertreter dieser spätmittelalterlichen Fachwerkbauweise. Ursprünglich wurde das Gebäude offenbar als Scheune erbaut und erhielt erst in späterer Zeit (wohl 17. Jahrhundert) eine Wohnnutzung. Dabei wurden Innenwände und u.a. eine Ofenwand mit Ofennische integriert. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgte ein gravierender Umbau, wobei insbesondere die Außenwände des Gebäudes weitestgehend durch Betonsteine ersetzt wurden.
1. Bauphase:
(1400 - 1450)
(1400 - 1450)
Der Gewölbekeller zeigt keinen Bezug zum aufgehenden Gebäude und dürfte daher einem Vorgängergebäude zugeordnet werden. Eine exakte Datierung war bislang nicht möglich. Denkbar wäre eine Errichtung in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Betroffene Gebäudeteile:

- Untergeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
2. Bauphase:
(1465 - 1466)
(1465 - 1466)
Die 2022 durchgeführte dendrochronologische Altersbestimmung belegt, dass die Bauhölzer des Gebäudes im Winter 1465/1466 gefällt wurden. Somit darf von einer Erbauung des Gebäudes im
Jahr 1466 (d) ausgegangen werden.
Jahr 1466 (d) ausgegangen werden.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Scheune
3. Bauphase:
(1650 - 1700)
(1650 - 1700)
Wohl in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte der Umbau/Umnutzung der Scheune zu einem Wohnhaus.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohnhaus
4. Bauphase:
(1960 - 1980)
(1960 - 1980)
Etwa in den 1970er Jahren wurden gravierende bauliche Veränderungen durchgeführt, wobei man große Teile der Außenwände durch Betonsteine ersetzte, Sanitärräume einrichtete und nahezu alle Fenster und Türen erneuerte.
Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Dachgeschoss(e)
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Zugeordnete Dokumentationen
- Dendrochronologische Altersbestimmung
- Bauhistorische Abbruchdokumentation
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Das Gebäude Gartenstraße 9 steht am südlichen Rand des historischen Ortskerns von Beuren. Nur wenige Meter nordwestlich des Anwesens befindet sich die Pfarrkirche.
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Bei dem Gebäude Gartenstraße 9 handelt es sich um ein giebelständiges, eingeschossiges Wohnhaus mit teils gemauerten, teils in Fachwerkbauweise errichteten, verputzten Außenwänden. Nach oben schließt das Gebäude mit zwei Dachgeschossebenen unter
einem Satteldach ab. An der nordwestlichen Traufseite befindet sich ein jüngerer Anbau mit Pultdach sowie ein Kellerhals mit großem, rundbogigen Kellertor.
einem Satteldach ab. An der nordwestlichen Traufseite befindet sich ein jüngerer Anbau mit Pultdach sowie ein Kellerhals mit großem, rundbogigen Kellertor.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
Die nordöstliche Gebäudehälfte ist unterkellert. Hier befindet sich ein großer Gewölbekeller, der über den Hausgrund des Erdgeschosses hinausreicht und somit keinen unmittelbaren Bezug zum aufgehenden Gebäude besitzt. Daher ist der Gewölbekeller als Rest eines Vorgängergebäudes anzusehen.
Das Erdgeschoss des Gebäudes besitzt eine Gliederung in zwei Längs- und drei Querzonen. Diese Zonierung ist identisch auch in den Dachgeschossen ablesbar. Bemerkenswert ist dabei, dass die mittlere Querzone ursprünglich keine Innenwände aufwies. Dies spricht dafür, dass es sich hier wohl um eine Scheunen-Tenne handelt und somit das Gebäude im Jahr 1466 (d) als Scheune erbaut wurde. Erst nachträglich wurden hier Innenwände eingezogen und im EG-Raum U.6 eine Küche eingerichtet.
Das 1. Dachgeschoss wurde wohl erst im 20. Jahrhundert zu Wohnzwecken ausgebaut. Zuvor diente es - genau wie das 2. Dachgeschoss - zu Lagerzwecken.
Das Erdgeschoss des Gebäudes besitzt eine Gliederung in zwei Längs- und drei Querzonen. Diese Zonierung ist identisch auch in den Dachgeschossen ablesbar. Bemerkenswert ist dabei, dass die mittlere Querzone ursprünglich keine Innenwände aufwies. Dies spricht dafür, dass es sich hier wohl um eine Scheunen-Tenne handelt und somit das Gebäude im Jahr 1466 (d) als Scheune erbaut wurde. Erst nachträglich wurden hier Innenwände eingezogen und im EG-Raum U.6 eine Küche eingerichtet.
Das 1. Dachgeschoss wurde wohl erst im 20. Jahrhundert zu Wohnzwecken ausgebaut. Zuvor diente es - genau wie das 2. Dachgeschoss - zu Lagerzwecken.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
keine Angaben
Bestand/Ausstattung:
Trotz der baulichen Veränderungen des 20. Jahrhunderts ist die primäre Tragkonstruktion
aus zwei Firstständern und dem Firsträhm noch komplett und eindrucksvoll überliefert. Auch darüber hinaus sind noch zahlreiche Fachwerkelemente (Stuhlständer, Steigbänder, Kopfbänder, Rähme, Deckenbalken und Lehmflechtwerkgefache) aus der Bauzeit erhalten. Innenwände waren aufgrund der ursprünglichen Scheunennutzung im 15. Jahrhundert kaum vorhanden. Somit ist die einstige Scheune in ihrer Konstruktion weitestgehend erhalten, lediglich die Rofen des Daches wurden im 20. Jahrhundert nahezu komplett durch Sparren ersetzt.
Im südwestdeutschen Raum sind nur sehr wenige Firstständergebäude mit einer derart vollständigen, originalen Baukonstruktion erhalten.
aus zwei Firstständern und dem Firsträhm noch komplett und eindrucksvoll überliefert. Auch darüber hinaus sind noch zahlreiche Fachwerkelemente (Stuhlständer, Steigbänder, Kopfbänder, Rähme, Deckenbalken und Lehmflechtwerkgefache) aus der Bauzeit erhalten. Innenwände waren aufgrund der ursprünglichen Scheunennutzung im 15. Jahrhundert kaum vorhanden. Somit ist die einstige Scheune in ihrer Konstruktion weitestgehend erhalten, lediglich die Rofen des Daches wurden im 20. Jahrhundert nahezu komplett durch Sparren ersetzt.
Im südwestdeutschen Raum sind nur sehr wenige Firstständergebäude mit einer derart vollständigen, originalen Baukonstruktion erhalten.
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
- Holzgerüstbau
- Hochfirstständergerüst
- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
- Flechtwerk
- Decken
- Balkendecke
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Dachform
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Rofendach
Konstruktion/Material:
Bei der Primärkonstruktion von Gartenstraße 9 handelt es sich um ein Firstständergerüst, welches noch weitestgehend überliefert ist. Beide bauzeitlichen Firstständer von 1466 (d) stehen an den Kreuzungspunkten der zwei Längs- und drei Querachsen und erstrecken sich noch in voller Länge vom Erdgeschoss-Fußboden bis zum Dachfirst. Die gesamte Dachwerkkonstruktion besteht aus rußgeschwärztem Eichenholz und wurde mit verblatteten Holzverbindungen gefügt. Bemerkenswert ist ferner der noch hohe Anteil an Innenwänden mit Lehmflechtwerk-Gefachen. Beim Dachtragwerk handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein
Rofendach, was aufgrund der wenigen überlieferten Rofen und der schwierigen Einsehbarkeit der Traufpunkte nicht zweifelsfrei zu klären ist. Die bauzeitliche Dachneigung lag bei ca. 52 Grad. Das Dachtragwerk wurde im 1. Dachgeschoss als zweifach stehende Stuhlkonstruktion errichtet. Die Queraussteifung erfolgt über Steigbänder (oder Langbänder), die die Stuhlständer überblatten. In Längsrichtung geschieht die Aussteifung über Kopfbänder zwischen den Stuhlständern und dem Stuhlrähm. Zusätzlich verlaufen Langbänder von den Firstständern zum Firsträhm. Blattsassen am Firsträhm legen nahe, dass sich hier ehemals Walmbundsparren befunden haben. Auch sonst sprechen alle Befunde dafür, dass das Gebäude ehemals über zwei Halbwalme verfügte.
Rofendach, was aufgrund der wenigen überlieferten Rofen und der schwierigen Einsehbarkeit der Traufpunkte nicht zweifelsfrei zu klären ist. Die bauzeitliche Dachneigung lag bei ca. 52 Grad. Das Dachtragwerk wurde im 1. Dachgeschoss als zweifach stehende Stuhlkonstruktion errichtet. Die Queraussteifung erfolgt über Steigbänder (oder Langbänder), die die Stuhlständer überblatten. In Längsrichtung geschieht die Aussteifung über Kopfbänder zwischen den Stuhlständern und dem Stuhlrähm. Zusätzlich verlaufen Langbänder von den Firstständern zum Firsträhm. Blattsassen am Firsträhm legen nahe, dass sich hier ehemals Walmbundsparren befunden haben. Auch sonst sprechen alle Befunde dafür, dass das Gebäude ehemals über zwei Halbwalme verfügte.