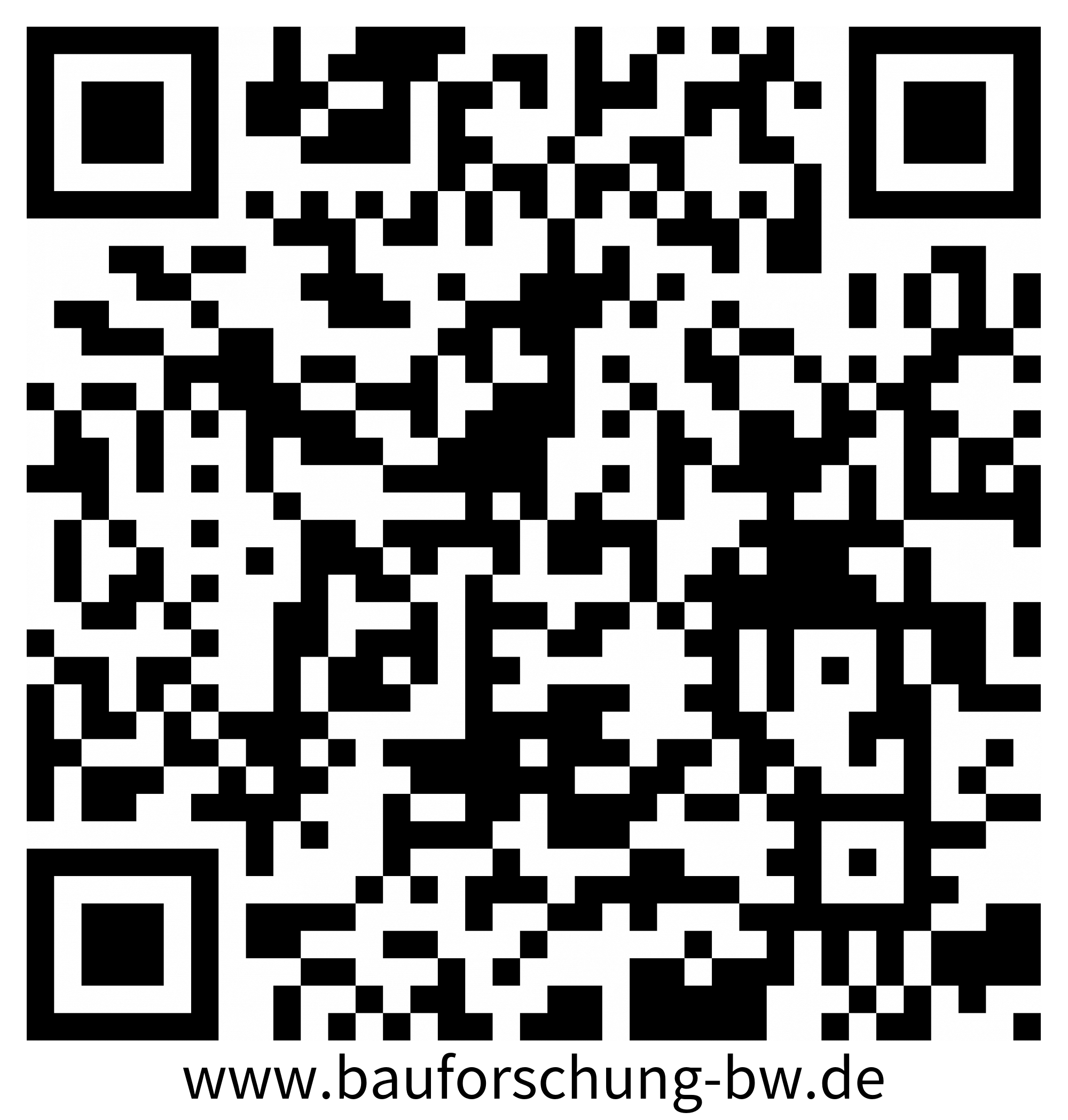Bahnhof, Empfangsgebäude
ID:
150004864610
/
Datum:
30.06.2025
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung
Objektdaten
| Straße: | Bronnwasenstraße |
| Hausnummer: | 20 |
| Postleitzahl: | 73614 |
| Stadt-Teilort: | Schorndorf-Haubersbronn |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Rems-Murr-Kreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8119067002 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
| Geo-Koordinaten: | 48,8243° nördliche Breite, 9,5503° östliche Länge |
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Durch Ihre Cookie-Auswahl haben Sie die Kartenansicht deaktiviert, die eigentlich hier angezeigt werden würde. Wenn Sie die Kartenansicht nutzen möchten, passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen unter Impressum & Datenschutzerklärung an.
Bauphasen
Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:
Die baulichen Maßnahmen am etwas mehr als 100 Jahre alten Empfangsgebäude von Schorndorf-Haubersbronn lassen sich in vier Bauphasen aufteilen, von denen drei genau datiert werden können: die Erbauung 1907, archivalisch nicht nachvollziehbare Veränderungen im 20. Jahrhundert und die Sanierung im Jahr 2002. Im Jahr 2025 wurde es aufgrund von irreparablen Schäden abgerissen.
1. Bauphase:
(1907)
(1907)
Als Empfangsgebäude für die Haltestelle Schorndorf-Haubersbronn wurde der Bau im Zuge der Einführung der Wieslauftalbahn 1907 zusammen mit sieben weiteren identischen (im Grundriss teilweise gespiegelten) Empfangsgebäuden erbaut.
Die Empfangsgebäude beinhalteten ein Dienstzimmer, einen Warteraum, sowie Privaträume für den jeweiligen Bahnangestellten mit Familie.
Die Empfangsgebäude beinhalteten ein Dienstzimmer, einen Warteraum, sowie Privaträume für den jeweiligen Bahnangestellten mit Familie.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
2. Bauphase:
(1950 - 1999)
(1950 - 1999)
Einzelne Baumaßnahmen wurden vermutlich in der 2. Hälfte oder gegen Ende des 20. Jahrhunderts vorgenommen, da sie keiner anderen Bauphase zugeordnet werden können. Dazu gehören der Austausch der meisten Fenster und Zusetzungen von Türöffnungen.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
3. Bauphase:
(2002)
(2002)
Die letzten Eigentümer des Empfangsgebäudes kauften es 2002 und nahmen geringfügige Veränderungen vor, wie unter anderem die Zweiteilung eines Raums und die Dämmung der Dachgeschosse.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
4. Bauphase:
(2025)
(2025)
Durch das Hochwasser im Juni 2024 wurden sowohl die Bahnlinie als auch das Empfangsgebäude beschädigt. Durch den Wassereintritt stürzte im Kellergeschoss ein Heizöltank um,
wodurch große Mengen Heizöl ausliefen und in die Wände und Böden eindrangen. Das Haus ist durch die Heizölbelastung nicht mehr sanier- oder bewohnbar und wurde daher im Juli 2025 abgerissen.
wodurch große Mengen Heizöl ausliefen und in die Wände und Böden eindrangen. Das Haus ist durch die Heizölbelastung nicht mehr sanier- oder bewohnbar und wurde daher im Juli 2025 abgerissen.
Betroffene Gebäudeteile:
keine
Zugeordnete Dokumentationen
- Restauratorische Untersuchung der Fassaden
- Bauaufnahme
- Bauhistorische Untersuchung und Baualterskartierung
Beschreibung
Umgebung, Lage:
Das ehemalige Empfangsgebäude befand sich in der Bronnwasenstraße 20 im Schorndorfer Stadtteil Haubersbronn. Die Bronnwasenstraße verläuft parallel zu den Bahnschienen auf östlicher Seite der Wieslauftalbahn, welche Haubersbronn von Süden - aus Schorndorf kommend - nach Norden - Richtung Miedelsbach - durchziehen. Sie verläuft geradlinig durch den Süden von Haubersbronn und knickt erst kurz vor der Mündung in die Wieslauftalstraße ab. Das Grundstück, auf dem das Wohnhaus stand, liegt mittig auf der westlichen Seite der Bronnwasenstraße und wird zu seiner anderen Seite von den Bahngleisen begrenzt. Nördlich und südlich des Gebäudes befinden sich Grünflächen.
Das Empfangsgebäude grenzte zudem direkt östlich an die Haltestelle „Haubersbronn“. Sie ist der 4. Halt auf der Strecke der Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Welzheim.
Etwa 100m westlich vom Gebäude befindet sich die Wieslauf, an deren Verlauf die Schienen der Wieslauftalbahn angepasst wurden.
Das Empfangsgebäude grenzte zudem direkt östlich an die Haltestelle „Haubersbronn“. Sie ist der 4. Halt auf der Strecke der Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Welzheim.
Etwa 100m westlich vom Gebäude befindet sich die Wieslauf, an deren Verlauf die Schienen der Wieslauftalbahn angepasst wurden.
Lagedetail:
- Siedlung
- Dorf
Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Bauten für Transport und Verkehr
- Bahnhof
- Bahnwärterhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Das Empfangsgebäude setzte sich aus zwei aneinandergefügten, im Inneren verbundenen Gebäudeteilen zusammen, unterschieden durch ihre Funktion. Der nördliche Teil war eingeschossig mit Krüppelwalmdach und steht traufständig zur Straße. Der südliche Teil ist zweigeschossig mit Satteldach und stand giebelständig zur Straße.
Der nördliche Gebäudeteil war im Osten und Westen vor der südlichen Gebäudefassade eingerückt und besaß einen schmaleren Grundriss.
Im Inneren waren die Gebäudeteile im Erd- und Dachgeschoss miteinander verbunden. Im Erdgeschoss waren die unterschiedlichen Gebäudeabschnitte durch einen Abfall des Bodenniveaus, bedingt durch die Unterkellerung des südlichen Gebäudes, deutlich zu erkennen.
Der nördliche Gebäudeteil war im Osten und Westen vor der südlichen Gebäudefassade eingerückt und besaß einen schmaleren Grundriss.
Im Inneren waren die Gebäudeteile im Erd- und Dachgeschoss miteinander verbunden. Im Erdgeschoss waren die unterschiedlichen Gebäudeabschnitte durch einen Abfall des Bodenniveaus, bedingt durch die Unterkellerung des südlichen Gebäudes, deutlich zu erkennen.
Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:
Zonierung:
Das Gebäude war in vier Ebenen gegliedert: Erdgeschoss, zwei Dachgeschosse und ein Kellergeschoss.
Das Erdgeschoss war in insgesamt acht Räume aufgeteilt. Der Haupteingang befand sich an der Südseite des Gebäudes. Dabei führte die Eingangstür in einen kleinen Verteilerraum, durch den sich drei weitere Räume erschließen ließen und der durch eine Treppe Zugang zum 1. Obergeschoss sowie zum Kellergeschoss ermöglichte.
Der rechte Gebäudeteil grenzte sich, wie schon in der Kubatur durch den Rücksprung ablesbar, konstruktiv durch eine massive Trennwand von den restlichen Räumen ab.
Die Treppe vom Erdgeschoss mündete im 1. Dachgeschoss in einen Verteilerraum, durch den vier Räume erschlossen werden konnten. Durch einen der Räume war der nördliche Gebäudeteil zu betreten.
Vom 1. Dachgeschoss führte eine Treppe weiter ins 2. Obergeschoss, welches aus dem komplett dachschrägen Spitzboden bestand. Er wurde durch zwei kleine Fenster an den beiden Giebelseiten belichtet.
Das Kellergeschoss wurde durch die Treppe vom Erdgeschoss erreicht und bestand aus vier Räumen, die alle bis auf einen von einer Preußischen Kappendecke abgeschlossen werden. Der übrige Raum hatte ein Tonnengewölbe.
Das Erdgeschoss war in insgesamt acht Räume aufgeteilt. Der Haupteingang befand sich an der Südseite des Gebäudes. Dabei führte die Eingangstür in einen kleinen Verteilerraum, durch den sich drei weitere Räume erschließen ließen und der durch eine Treppe Zugang zum 1. Obergeschoss sowie zum Kellergeschoss ermöglichte.
Der rechte Gebäudeteil grenzte sich, wie schon in der Kubatur durch den Rücksprung ablesbar, konstruktiv durch eine massive Trennwand von den restlichen Räumen ab.
Die Treppe vom Erdgeschoss mündete im 1. Dachgeschoss in einen Verteilerraum, durch den vier Räume erschlossen werden konnten. Durch einen der Räume war der nördliche Gebäudeteil zu betreten.
Vom 1. Dachgeschoss führte eine Treppe weiter ins 2. Obergeschoss, welches aus dem komplett dachschrägen Spitzboden bestand. Er wurde durch zwei kleine Fenster an den beiden Giebelseiten belichtet.
Das Kellergeschoss wurde durch die Treppe vom Erdgeschoss erreicht und bestand aus vier Räumen, die alle bis auf einen von einer Preußischen Kappendecke abgeschlossen werden. Der übrige Raum hatte ein Tonnengewölbe.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Das Empfangsgebäude war bis zum Hochwasser im Juni 2024 als Wohngebäude in Nutzung und war unter Beibehaltung eines Großteils des bauzeitlichen Bestandes saniert.
Während des Hochwassers stürzte durch den Wassereintritt im Kellergeschoss ein Heizöltank um, wodurch große Mengen Heizöl ausliefen und in die Wände und Böden eindrangen. Das Haus war durch die Heizölbelastung nicht mehr sanier- oder bewohnbar und wurde daher abgerissen.
Während des Hochwassers stürzte durch den Wassereintritt im Kellergeschoss ein Heizöltank um, wodurch große Mengen Heizöl ausliefen und in die Wände und Böden eindrangen. Das Haus war durch die Heizölbelastung nicht mehr sanier- oder bewohnbar und wurde daher abgerissen.
Bestand/Ausstattung:
Neben allen Türblättern und vier Fenstern war noch weitere bauzeitliche Ausstattung erhalten, wie beispielsweise die Vertäfelung des ehemaligen Warteraums und der Fahrkartenschalter.
Konstruktionen
Konstruktionsdetail:
- Gewölbe
- Preußische Kappen
- Tonnengewölbe
- Dachform
- Krüppelwalmdach
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Rofenpaar mit Rofenpaarbalken
Konstruktion/Material:
Das gesamte Empfangsgebäude stand auf einem Sockel aus Beton. Der nördliche Gebäudeteil baute darauf in Fachwerk auf, welches im 1. Dachgeschoss durch Holzlatten verkleidet war. Die
Gefachfüllung unter dem Putz war an keiner Stelle einzusehen und Materialien sind auch nicht in den Bestandsplänen vermerkt.
Der südliche Gebäudeteil bestand im Erdgeschoss aus verputztem Backsteinmauerwerk und Fachwerk, im 1. Dachgeschoss aus Fachwerk (Außenwände verschindelt) und im Kellergeschoss aus Bruchsteinmauerwerk mit vereinzeltem Backsteinmauerwerk.
Das Erd- und 1. Dachgeschoss schlossen mit von unten verkleideten Balkendecken ab. Im Kellergeschoss hatten drei Räume eine Preußische Kappendecke, bei der statt Stahlträgern Eisenbahnschienen zum Einsatz kamen. Der vierte Raum schloss mit einem Tonnengewölbe aus Backsteinmauerwerk ab.
Dachwerk
Die Dachkonstruktionen waren im Inneren des Hauses wegen Wandverkleidungen nur begrenzt einsehbar. Die Außenansichten ließen bei beiden Gebäudeteilen auf eine Rofenddachkonstruktion schließen, aufgrund der tiefen Dachüberhänge, die durch hervorstehenden Rofen gebildet wurden, und die hervorstehenden Pfetten an den
Giebeln.
Im 1. Dachgeschoss bestätigte die sichtbare Konstruktion diese Vermutung für den nördlichen Gebäudeteil. Die Zwischenpfetten auf beiden Seiten wurden von abgesprengten, stehenden Stuhlständern getragen und durch Kopfbänder verstärkt. Da die verkleideten Spanplatten keinen First bildetn, sondern durch eine waagerechte Spanplatte trapezförmig abschließen, liegt die Vermutung nahe, dass sich darunter eine Firstpfette befand. Der Bestandsplan von 1902 bestätigt dies und zeigt zudem noch sechs Rofenpaarbalken, die paarweise unter der Firstpfette je ein Rofenpaar verbinden.
Für den südlichen Gebäudeteil gab ein unverkleideter Raum Aufschluss: Hier war die Fußpfette zu sehen, auf der die Rofen auflagen. Im 2. Dachgeschoss waren zudem die Firstpfette mit acht Rofenpaarbalken unter der Verkleidung auszumachen. Auch diese lagen paarweise unter der Firstpfette an je einem Rofenpaar und dienten möglicherweise der auf beiden Seiten über die Außenmauern überkragenden Firstpfette als Stütze. Auch diese Konstruktion ist in den Bestandsplänen von 1902 sichtbar.
Gefachfüllung unter dem Putz war an keiner Stelle einzusehen und Materialien sind auch nicht in den Bestandsplänen vermerkt.
Der südliche Gebäudeteil bestand im Erdgeschoss aus verputztem Backsteinmauerwerk und Fachwerk, im 1. Dachgeschoss aus Fachwerk (Außenwände verschindelt) und im Kellergeschoss aus Bruchsteinmauerwerk mit vereinzeltem Backsteinmauerwerk.
Das Erd- und 1. Dachgeschoss schlossen mit von unten verkleideten Balkendecken ab. Im Kellergeschoss hatten drei Räume eine Preußische Kappendecke, bei der statt Stahlträgern Eisenbahnschienen zum Einsatz kamen. Der vierte Raum schloss mit einem Tonnengewölbe aus Backsteinmauerwerk ab.
Dachwerk
Die Dachkonstruktionen waren im Inneren des Hauses wegen Wandverkleidungen nur begrenzt einsehbar. Die Außenansichten ließen bei beiden Gebäudeteilen auf eine Rofenddachkonstruktion schließen, aufgrund der tiefen Dachüberhänge, die durch hervorstehenden Rofen gebildet wurden, und die hervorstehenden Pfetten an den
Giebeln.
Im 1. Dachgeschoss bestätigte die sichtbare Konstruktion diese Vermutung für den nördlichen Gebäudeteil. Die Zwischenpfetten auf beiden Seiten wurden von abgesprengten, stehenden Stuhlständern getragen und durch Kopfbänder verstärkt. Da die verkleideten Spanplatten keinen First bildetn, sondern durch eine waagerechte Spanplatte trapezförmig abschließen, liegt die Vermutung nahe, dass sich darunter eine Firstpfette befand. Der Bestandsplan von 1902 bestätigt dies und zeigt zudem noch sechs Rofenpaarbalken, die paarweise unter der Firstpfette je ein Rofenpaar verbinden.
Für den südlichen Gebäudeteil gab ein unverkleideter Raum Aufschluss: Hier war die Fußpfette zu sehen, auf der die Rofen auflagen. Im 2. Dachgeschoss waren zudem die Firstpfette mit acht Rofenpaarbalken unter der Verkleidung auszumachen. Auch diese lagen paarweise unter der Firstpfette an je einem Rofenpaar und dienten möglicherweise der auf beiden Seiten über die Außenmauern überkragenden Firstpfette als Stütze. Auch diese Konstruktion ist in den Bestandsplänen von 1902 sichtbar.