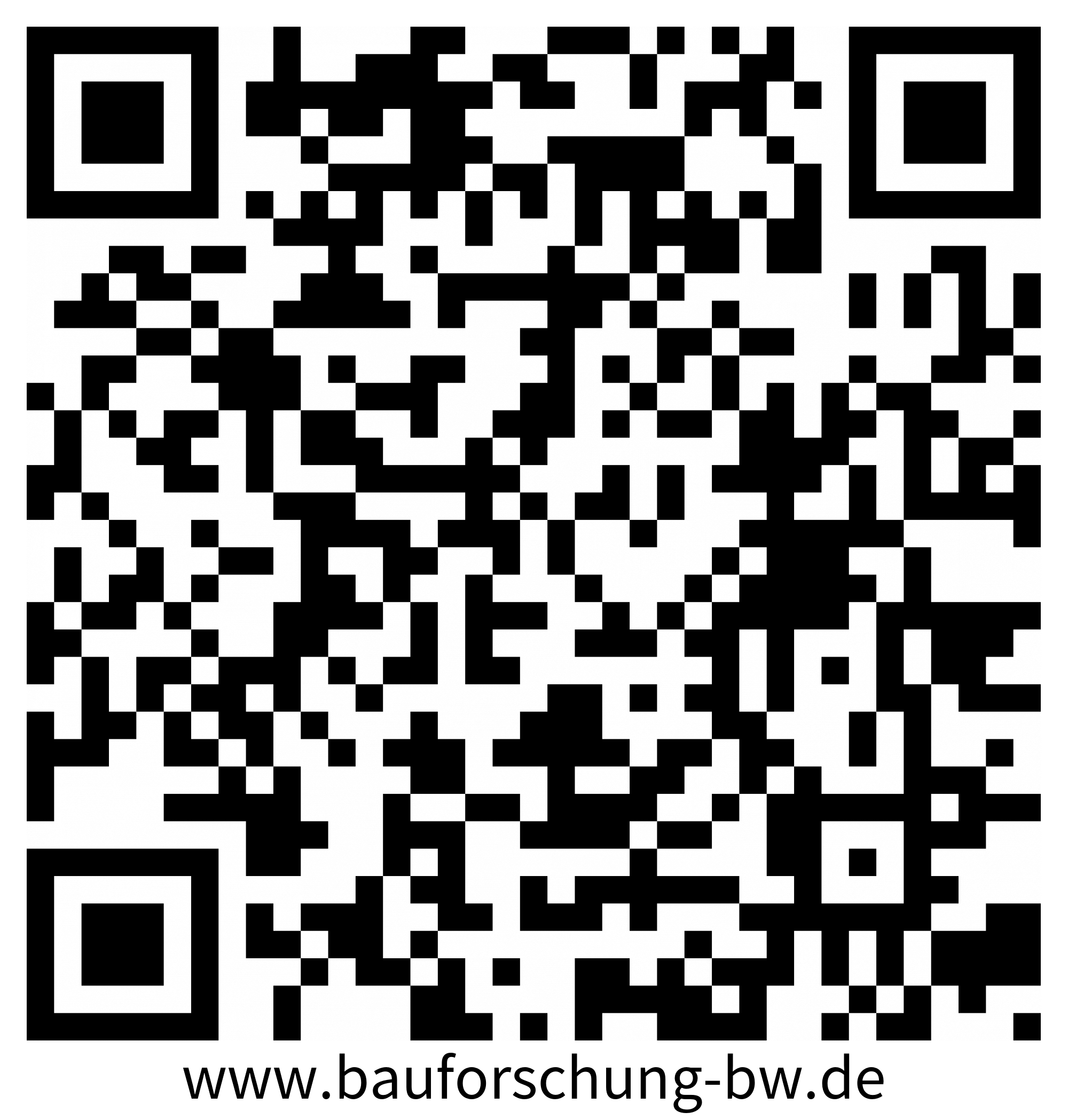Ehem. Buhl’sche Mühle
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Pforzheimer Straße |
| Hausnummer: | 68 |
| Postleitzahl: | 76275 |
| Stadt-Teilort: | Ettlingen |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
| Kreis: | Karlsruhe (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8215017004 |
| Flurstücknummer: | 1639 |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
Wohn- und Geschäftshaus (76275 Ettlingen, Albstraße 15)
Gut Watthalden, Pforzheimer Straße 67 (76275 Ettlingen)
Wohnhaus, Pforzheimer Straße 69 (76275 Ettlingen)
Bauphasen
Die Ettlinger Papiermühle „In der Watt“ wird durch Markgraf Christoph von Baden im Jahr 1452 erbaut und ist für die Jahre 1482 und 1495 urkundlich belegbar. Die Mühle wird 1689 im Pfälzer Erbfolgekrieg niedergebrannt und wieder aufgebaut. Im Jahr 1791 brennt die Mühle erneut bis auf die Grundmauern ab. Kaufmann Franz Albert Buhl erwirbt die Gebäudereste bzw. das Grundstück samt Wasserrechte. Der Wiederaufbau wird sofort begonnen und zusätzliche Mühlräder eingebaut. Im Jahre 1802 baut Buhl auf der anderen Seite des Mühlgrabens zwei kleine Häuschen, deren Bauzeit inschriftlich im Türsturz festgehalten wurde (1802). Diese wurden über einen Holzsteg mit der Mühle verbunden. 1824 wird die Mühle durch Hochwasser stark beschädigt. Mitte des 19. Jahrhunderts folgt die Umfunktionierung, zumindest des 1. OG des Anbaus, zu Wohnzwecken. Das Mühlengebäude wird um 1854 für die Nutzung als Lager, Schreinerei und zu Wohnzwecken umgebaut. 1896 werden die Trocknungsvorrichtung im Dachboden des Mühlengebäudes ausgebaut. Im Jahr 1904 wurde in der Nähe der alten Mühle das zweigeschossige Dienstwohnhaus gebaut. 1930 wird das Mühlen- und Lagergebäude innen wie außen saniert und mit weiteren Wohnungen versehen. Im Jahre 1963 wurde das Mühlengebäude nochmals umgebaut und zwischen 1992-1997 nicht mehr benutzt. Im Jahr 1997 brennen Teile des Dachstuhls am Mühlengebäude nieder.
In Jahren 2004-2005 erfolgte der bislang letzte Umbau, mit dem die Sanierung der Mühle und den zwei Anbauten einherging. Die Anlage wurde zum Tagungszentrum umfunktioniert. Der Eingangsbereich erstreckt sich fortan über das gesamte Erdgeschoss. Das 1. Obergeschoss unterteilt sich in einen großen und einen kleinen Veranstaltungsraum. Das Dachgeschoss wurde zu einem geräumigen Bankettsaal ausgebaut. Die Treppenfuge wurde komplett entkernt und mit einer Stahltreppe gefüllt.
(1482 - 1495)
(1689)
(1791)
- Gewerbe- und Industriebauten
- Mühle
(1802)
(1824)
(1854 - 1896)
- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Gewerbe- und Industriebauten
- Werkstattgebäude
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
- Lagergebäude
(1930 - 1992)
- Wohnbauten
- Wohnhaus
(1992 - 1997)
(1997)
(2004 - 2005)
Zugeordnete Dokumentationen
- Raumbuch
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Gewerbe- und Industriebauten
- Mühle
Zonierung:
Das Erdgeschoss war ursprünglich in einen großen Lagerraum und zwei Treppenhäuser untergliedert. Die Produktions- und Lagerhalle nimmt 2/3 des Erdgeschosses ein und wurde im Südwesten nachträglich in mehrere kleine Räume unterteilt. Im verbleibenden Drittel wurden gewerbliche Räume, eine Küche und Aufenthaltsräume untergebracht. Im Südosten der Lagerhalle befindet sich eine Holztreppe ins Obergeschoss, eine weitere Treppe ins 1. Obergeschoss befindet sich im Nordosten des Gebäudes.
Das 1. Obergeschoss ist in zwei Wohnungen, die über zwei getrennte Treppenhäuser erschlossen werden, aufgeteilt.
Die Erschließung des 1. Dachgeschosses erfolgt über das westliche Treppenhaus. Im 1. Dachgeschoss wurde nur auf der Südostseite eine Wohnung eingebaut. Der östliche Teil des Geschosses besteht aus einem großen Raum, der ca. zwei Drittel der Geschossfläche einnimmt. Das 2. Dachgeschoss besteht aus einem großen Raum. Die Erschließung der oberen Dachgeschosse liegt im Südosten. Das 3. Dachgeschoss weist einen Spitzbogen auf.
Eine Reihung der großen Korbbogentore im Erdgeschoss belegt die Ebene der Produktion, wogegen im Dachraum, durch die Lüftungsläden u.a., die ehem. Funktion der Trockenräume ebenfalls noch nachvollziehbar ist.
Konstruktionen
- Mischbau
- Steinbau mit Gebäudeteilen aus Holz
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
- Balkendecke
- Verwendete Materialien
- Holz
- Stein
- Holzgerüstbau
- Geschossgerüst
- Steinbau Mauerwerk
- Bruchstein
- Dachform
- Mansardwalmdach
- Schopfwalm (Krüppelwalm)
Die Südwestfassade verlief ursprünglich entlang des Mühlengrabens; an dieser Seite befanden sich entsprechend einst die Mühlenräder. Eine überdachte Holzbrücke verbindet das erste Stockwerk der Buhl’schen Mühle mit dem Obergeschoss des gegenüberliegenden Gebäudes.
Die Giebelfassade im Nordwesten ist annähernd achsensymmetrisch aufgebaut. Im Erdgeschoss und dem darüber liegenden Stockwerk befinden sich jeweils vier Fensterachsen. Die erste Dachebene ist ebenfalls in vier Fensterachsen unterteilt, wobei die zweite Dachebene nur noch zwei Fensterachsen aufweist.
Der Raum in der Westecke des Kellergeschosse diente in früherer Zeit vermutlich als Sumpfbecken. Hier ist das Natursteinmauerwerk aus gelbem und rotem Sandstein verputzt und gestrichen. Die Holzbalkendecke ist mit Lehm-Strohgemisch ausgefacht. Eine Treppe führt ins Erdgeschoss. Der Fußboden im Erdgeschoss liegt ca. 0,5 m unter den Erdbodenniveau und besteht in Teilen lediglich aus verdichtetem Erdreich. Die Balkendecke zum 1. Obergeschoss ist auf der Unterseite nicht verkleidet. Die Balken laufen über die nachträglich eingezogenen Trennwände hinweg.
Im 1. Obergeschoss beträgt die Raumhöhe ca. 3, 20 m. Bei den Innenwänden handelt es sich um beplankte Holzständerkonstruktionen. In den Wohnräumen sind Holzdielenböden und Holzbalkendecken vorhanden.
Das Mansarddach mit Schopf weist eine Sparrenverbindung über liegendem Stuhl mit Mittelstützen auf. Das Dach erstreckt sich über 3 Geschosse. In der Mittelachse des 1. und 2. Dachgeschosses wurden die Trocknungsgerüste eingebaut. Die Stützen im 1. Dachgeschoss sind im oberen Teil H-förmig ausgearbeitet und in den Flanschen mit Bohrungen versehen. Die Stuhlsäulen im 1. und 2. Dachgeschoss sind gelocht. Durch diese Löcher wurden Schnüre gezogen. An die Stuhlsäulen im 1. Dachgeschoss wurden gelochte Bretter angenagelt.