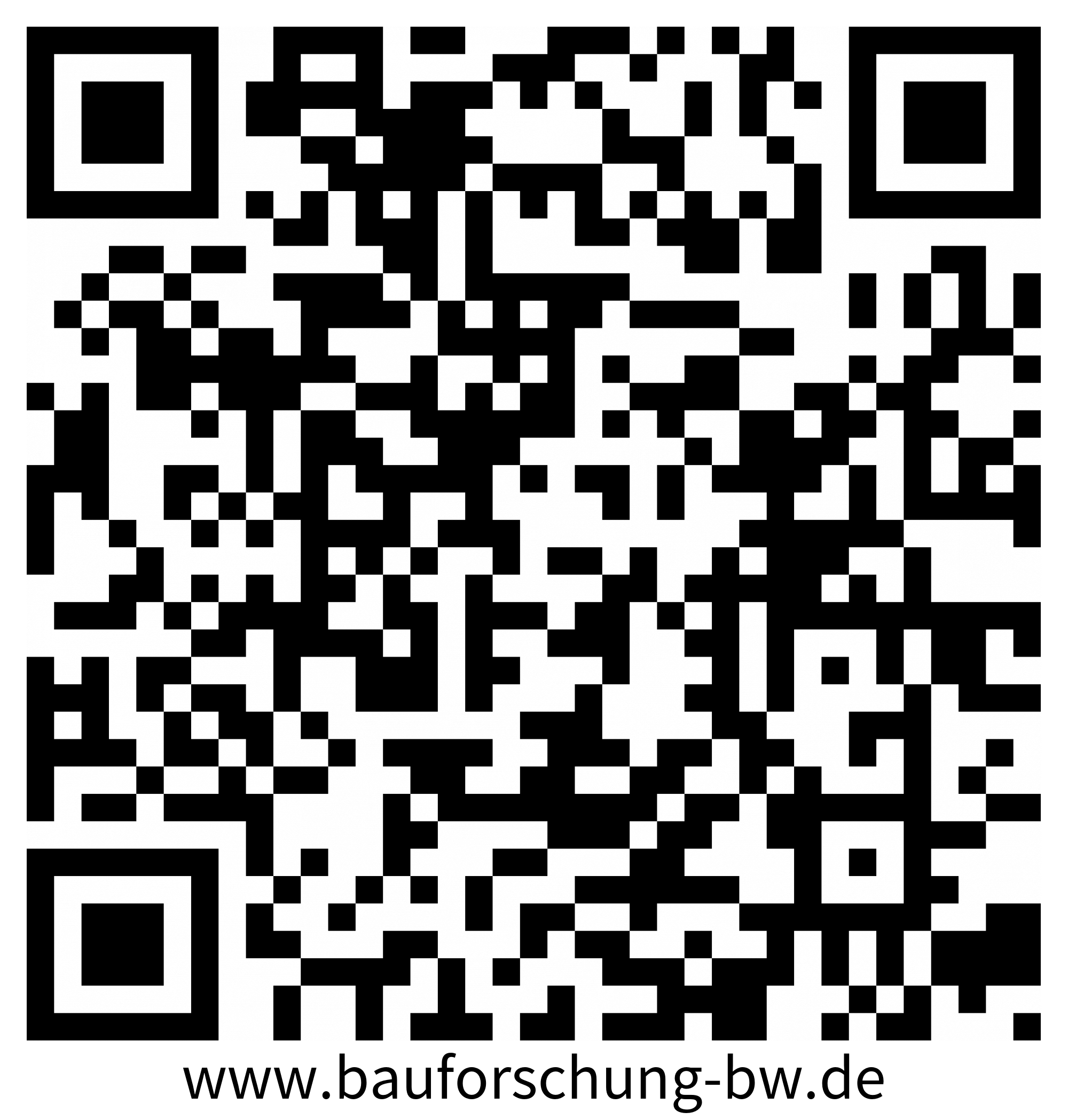Wohnhaus
Datenbestand: Bauforschung
Objektdaten
| Straße: | Priestergasse |
| Hausnummer: | 19 |
| Postleitzahl: | 73479 |
| Stadt-Teilort: | Ellwangen (Jagst) |
|
|
|
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Kreis: | Ostalbkreis (Landkreis) |
| Wohnplatzschlüssel: | 8136019012 |
| Flurstücknummer: | keine |
| Historischer Straßenname: | keiner |
| Historische Gebäudenummer: | keine |
| Lage des Wohnplatzes: |

|
Kartenansicht (OpenStreetMaps)
ehem. Stiftsherrenhaus (73479 Ellwangen, Apothekergasse 3)
Handwerkerhaus (73479 Ellwangen, Hafnergasse 5)
ehem. Nikolauspflege (73479 Ellwangen, Hallerstraße 9)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Marienstraße 15)
Wohnhaus, Marienstraße 1 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Marienstraße 22)
Wohn- und Geschäftshaus, Marktplatz 13 (73479 Ellwangen)
Kapitularhaus, Marktplatz 21 (73479 Ellwangen)
evangelische Stadtkirche (Jesuiten) (73479 Ellwangen, Marktplatz 5)
Wohnhaus, Oberamtsstraße 14 (73479 Ellwangen)
Wohnhaus, Oberamtsstraße 9 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Pfarrgasse 10)
Wohnhaus, Pfarrgasse 18 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus, Pfarrgasse 4 (73479 Ellwangen)
Wohn- und Geschäftshaus (73479 Ellwangen, Pfarrgasse 8)
Chorherrenstift - Ostflügel (73479 Ellwangen, Philipp-Jeningen-Platz 2)
Ehem. Statthalterei (73479 Ellwangen, Philipp-Jeningen-Platz 4)
Bauphasen
Nach momentanem Kenntnisstand soll das Wohnhaus Priestergasse 19 um 1566 errichtet worden sein. Es wurde unmittelbar an die bereits bestehende Stadtmauer angebaut. Ursprünglich soll das Gebäude als Wohnhaus des Chorvikars gedient haben.
Wohl im 18. oder frühen 19. Jahrhundert erfolgt eine umfassende Sanierungs- und Barockisierungsmaßnahme am Gebäude. An der nordöstlichen Seite wurde ein neues Treppenhaus im Bereich der Stadtmauer (bzw. über der Stadtmauer) angebaut.
Die straßenseitige, südwestliche Fassade wurde in den beiden Vollgeschossen massiv aus Backsteinen erneuert bzw. innenseitig eine Art Vorsatzschale aus Backsteinen davor gesetzt. Im Innern erfolgte eine neue Grundrissgliederung, das 1. Dachgeschoss dürfte zudem in dieser Zeit zu Wohnzwecken ausgebaut worden sein. Ebenfalls in dieser "spätbarocken" Umbauphase wurden wohl nahezu alle Gefache mit Backsteinen ausgemauert. Vom Ursprungsgebäude des 16. Jahrhunderts scheint sich im wesentlichen nur noch die primäre Fachwerk- und Dachwerk-Tragkonstruktion erhalten zu haben.
(1566)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Mischbau
- Obergeschoss(e) aus Holz
(1700 - 1800)

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Untergeschoss(e)
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
- Mischbau
- Obergeschoss(e) aus Holz
Zugeordnete Dokumentationen
- Bauhistorische Kurzuntersuchung
Beschreibung
- Siedlung
- Stadt
- Wohnbauten
- Wohnhaus
Zonierung:
Die bauzeitliche Grundrissgliederung des 16. Jahrhunderts lässt sich im Erdgeschoss nur noch schwer nachvollziehen. Umbaumaßnahmen des 18./19. Jahrhunderts haben hier zu einer Neustrukturierung der Raumaufteilung geführt.
Das Erdgeschoss wurde zuletzt zu Wohnzwecken genutzt. Das Obergeschoss zeigt noch eine Untergliederung in zwei Querzonen und "ansatzweise" in drei Längszonen. Die Längszonen sind nur noch über die beiden Außenwand-Knaggen über dem Treppenhaus zu lokalisieren. Aufgrund der Abbundseiten der Fachwerkkonstruktion ist am ehesten in der östlichen Gebäudeecke die ehemalige Stube des 16. Jahrhunderts zu vermuten. Das Obergeschoss dient zu Wohnzwecken.
Das 1. Dachgeschoss dürfte bereits im 18. oder frühen 19. Jahrhundert zu Wohnzwecken ausgebaut worden sein. Hier lässt sich am spätmittelalterlichen Dachtragwerk noch gut die Gliederung mit vier Querzonen ablesen.
Das 2. Dachgeschoss ist nicht ausgebaut und dient zu Lagerzwecken.
Konstruktionen
- Mischbau
- Obergeschoss(e) aus Holz
- Decken
- Balkendecke
- Gewölbe
- Tonnengewölbe
- Dachform
- Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
- Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
Im Obergeschoss zeichnet sich eine Fachwerkkonstruktion ab, die im 18./19. Jahrhundert weitestgehend neu mit Backsteinen ausgefacht wurde.
Im 1. Dachgeschoss ist die Dachwerkskonstruktion teilweise einsehbar. Hier wurde eine zweifach liegende Stuhlkonstruktion aus Nadelholz errichtet, die mit verblatteten Verbindungen gefügt wurde. Die Hölzer zeigen eine Rußschwärzung, was für ein ehemals "kaminloses" Rauchdach spricht.
Die insgesamt fünf Querbünde unterteilen das Tragwerk in vier Querzonen.
Die Querbundachsen besitzen Abbundzeichen in Form von Dreieckskerben. Die hier vom Zimmermann verwendete Sparrenzählung läuft kontinuierlich durch, d.h. das gesamte
Dachtragwerk scheint einheitlich und zeitgleich errichtet worden zu sein.
Das Dachtragwerk wurde offensichtlich bereits dendrochronologisch datiert. Jedoch konnte bislang nirgends das dazugehörige Gutachten ausfindig gemacht werden. Laut Liste der Kulturdenkmale soll die Datierung des Dachtragwerks auf das Jahr 1566 fallen.